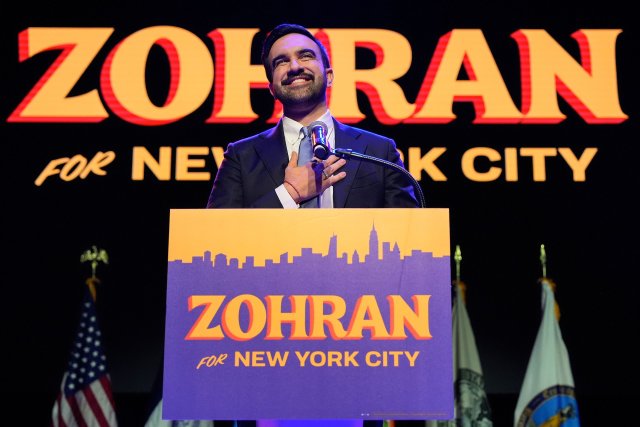Wie kann die LINKE auf die AfD reagieren?
Sabine Zimmermann und Jan Korte fragen nach Antworten auf den Rechtsruck - und wollen sich um die Mittelschicht kümmern
Der beängstigende Aufstieg der AfD sorgt auch in der LINKEN für Unruhe. Vor allem die Frage, ob und wie man AfD-Wähler zurückholt oder überzeugt, das nächste Mal ihr Kreuz bei der Linkspartei zu machen, wird heftig diskutiert. Neue Nahrung bekam die Debatte durch ein Interview, das Fraktionschefin Sahra Wagenknecht in der vergangenen Woche dem »Stern« gegeben hatte. Darin hatte sie Kanzlerin Angela Merkel mitverantwortlich für den Berliner Terroranschlag gemacht - unter anderem wegen »der unkontrollierten Grenzöffnung«. Die Parteispitze ging auf Distanz. Parteichef Bernd Riexinger bezeichnete es als »in höchstem Maße falsch und in höchstem Maße gefährlich«, einen Zusammenhang zwischen der Flüchtlingsfrage und dem Terrorismus herzustellen.
In einem weiteren Interview mit dem »Deutschlandfunk« erklärte Wagenknecht später, dass sie frustrierte AfD-Wähler zurückholen wolle. Nun hat sie in einem Gespräch mit der »Stuttgarter Zeitung« ihre Position bekräftigt: »Ich will die erreichen, die aus Verärgerung und Frust über die herrschende Politik darüber nachdenken, der AfD ihre Stimme zu geben«, so Wagenknecht. Zumindest in diesem Punkt ist sie mit Parteichef Bernd Riexinger einer Meinung. Auch er will erklärtermaßen Wechselwähler, die der AfD ihre Stimme gegeben haben, zurückgewinnen.
Die Frage ist nur, wie weit darf eine linke Partei dabei gehen? Und wie überzeugt man die Frustrierten und Enttäuschten? In einem gemeinsamen Papier, das »neues deutschland« vorliegt, suchen die beiden Vize-Fraktionschefs der LINKEN, Sabine Zimmermann und Jan Korte, nach Antworten. Wer wissen will, wie er Wähler zurückholt, muss sich zuerst darüber klar sein, wer sich von der Parolen der AfD angesprochen fühlt. Der Befund ist bitter: »Sowohl in Baden-Württemberg, als auch in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin war sie stärkste Partei bei Arbeiterinnen und Arbeitern und Erwerbslosen«.
Exemplarisch sind die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt: Hier wählten 37 Prozent der Arbeiter die AfD, während die LINKE auf 13 Prozent kam und die SPD auf neun Prozent abstürzte. Nur bei den Arbeitslosen schnitten die Rechtspopulisten mit 38 Prozent noch besser ab.
Zwar hätten auch »ausländer- und islamfeindliche Einstellungen eine nicht unwesentliche Rolle« gespielt, doch sei die Protestwahl auch Ausdruck von sozialer Unsicherheit und Abstiegsängsten, unterstreichen Korte und Zimmermann. »Auch diejenigen Arbeitnehmer, die noch über relativ gute Löhne verfügen, (...) sehen die Bedrohung ihrer Existenz alltäglich in ihrem Umfeld bei jenen, auf die die sozialen Risiken verlagert werden«, heißt es im Papier. Denn neben ihnen stünden Kollegen, »die die gleiche Arbeit verrichten, aber weniger Lohn erhalten«. In der neoliberalen Abstiegsgesellschaft liegen die Nerven blank: »Die gesellschaftliche Mitte verkörpert nicht mehr die beruflichen Aufstiegshoffnungen, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg einmal war«. Die Perspektive sei vielmehr »der drohende Verlust ihrer Arbeit oder die Reduzierung ihres Einkommens«.
Zimmermann und Korte warnen: »Wenn große Gruppen in der Gesellschaft zusehen müssen, wie sie von der Politik und der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt und benachteiligt werden, und die Politik nichts dagegen unternimmt, werden alle Appelle an die Vernunft und die gesellschaftliche Solidarität wirkungslos bleiben.«
Die beiden Autoren verweisen auf das Buch des französischen Soziologen Didier Eribon »Rückkehr nach Reims«. Dort beschreibt das Arbeiterkind Eribon die Hinwendung der vormals kommunistisch und sozialistisch wählenden Arbeiterschaft zur rechtsradikalen Front National. Eribon bezeichnet den Seitenwechsel »als eine Art Notwehr der unteren Schichten«. Sie versuchten, so der Soziologe, ihre Identität und Würde zu bewahren, »die seit je mit Füßen getreten worden ist und sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten«.
Im Gespräch mit »neues deutschland« betonte Sabine Zimmermann am Freitag: »Wir als LINKE dürfen uns nicht nur auf die Arbeitslosen konzentrieren, sondern müssen stärker als bisher auch die Facharbeiter, die Scheinselbstständigen und Leiharbeiter im Fokus haben«. Die LINKE müsse deutlicher machen, dass sie das »soziale Gewissen der Republik« sei. »Wir müssen uns mehr als bisher um die Mittelschicht kümmern«, so Zimmermann, die das Papier als »Denkanstoß« verstanden wissen will. Folgerichtig resümieren Zimmermann und Korte, dass das »wirkungsvollste Gegenmittel gegen den wachsenden Rechtspopulismus« immer noch die soziale Sicherheit sei.
An diesem Wochenende trifft sich der Parteivorstand der LINKEN mit den Landes- und Fraktionsvorsitzenden, sowie dem Vorstand der Bundestagsfraktion, dabei soll es auch um den Entwurf des Wahlprogramms gehen. Es steht unter dem Motto: »Sozial.Gerecht.Für alle«.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.