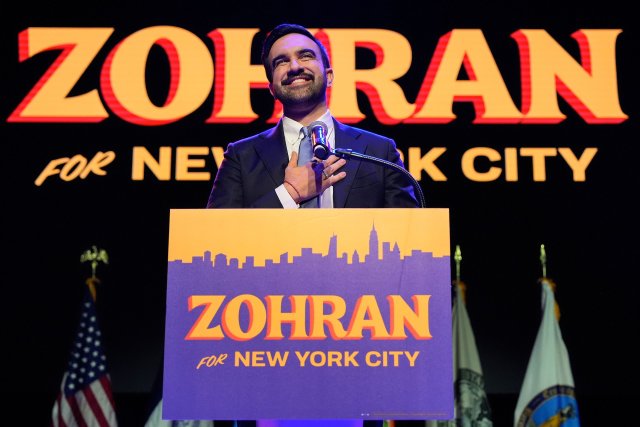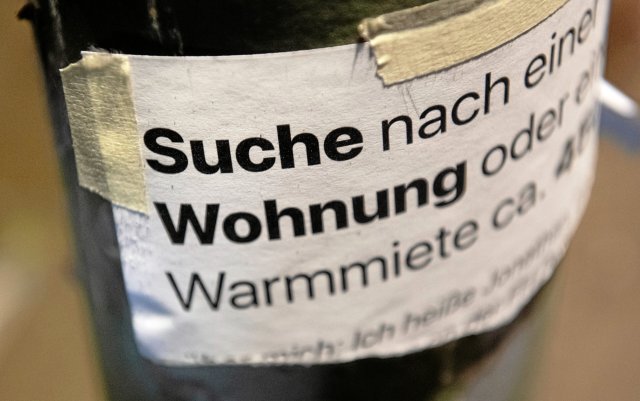Der Anti-Terror-Paragraf
Der Paragraf 129b wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eingeführt. Mit ihm wurde der bis dato existierende Straftatbestand §129a (»Bildung einer terroristischen Vereinigung«) erweitert, um im Ausland agierende »terroristische Vereinigungen« auch auf deutschem Staatsgebiet strafrechtlich verfolgen zu können.
Der Paragraf 129a wiederum wurde 1976 im Zuge der Anti-Terror-Kampagne gegen die RAF eingeführt. Schon damals kritisierten Bürgerrechtler unter anderem die damit geschaffenen Sonderrechte für Behörden bei der Ermittlung gegen mutmaßliche Mitglieder terroristischer Vereinigungen und sahen in dem Straftatbestand den Versuch der Einschüchterung politischer Aktivisten.
Der Paragraf 129b ist noch umstrittener, weil sich deutsche Gerichte dabei oft auf Informationen ausländischer Behörden verlassen müssen. Die Generalbundesanwaltschaft muss bei 129-Fällen beim Justizministerium eine Ermächtigung beantragen. Einer kleinen Anfrage der LINKEN zufolge wurde diese insgesamt 110-mal erteilt und nur elfmal versagt. Besonders häufig, 36-mal, ging es dabei um türkische und kurdische Organisationen. jos
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.