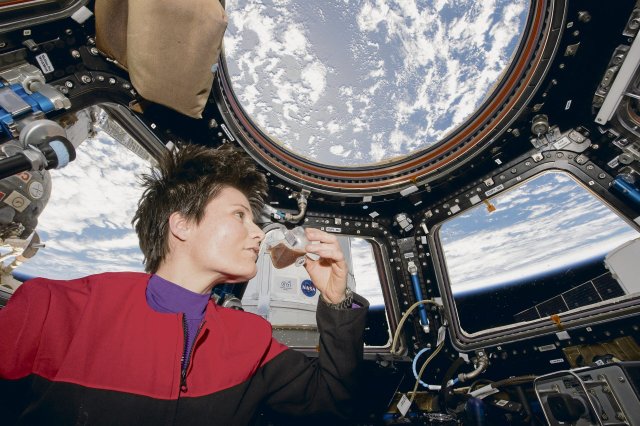Jenseits des Determinismus
Vor 100 Jahren wurde der Meteorologe Edward N. Lorenz geboren. Es gilt als Vater der modernen Chaostheorie
Wissenschaftler haben den Code des Lebens entziffert. Sie schicken Raumschiffe zu fernen Planeten und entwickeln Computer, die im Schach den Weltmeister schlagen. Fragt man sie allerdings, wie in zwei Wochen das Wetter sein wird, können sie nur mutmaßen. Grund für diese »Bescheidenheit« ist eine Eigenschaft der Atmosphäre, die man etwas unglücklich Chaos nennt. Denn der aus dem Griechischen stammende Begriff bedeutet eigentlich »gähnende Leere«. Manche verstehen darunter auch ein wüstes Durcheinander. Dagegen liegt dem von Meteorologen verwendeten Chaosbegriff eine deterministische Regelhaftigkeit zugrunde, die dennoch nicht verhindert, dass sich das Wettergeschehen einer langfristigen Vorhersage entzieht.
Entdeckt hat dieses Phänomen der Meteorologe Edward N. Lorenz, der am 23. Mai 1917 in West Hartford im US-Bundesstaat Connecticut geboren wurde. Er studierte zunächst Mathematik am Dartmouth College in New Hampshire sowie an der Harvard University, wo er 1940 seinen Masterabschluss machte. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Lorenz für das United States Army Air Corps. Seine wichtigste Aufgabe bestand darin, Wettervorhersagen zu erstellen. Da ihn dieses schwierige Problem auch später nicht losließ, begann er 1946 Meteorologie zu studieren, am Massachusetts Institute of Technology (MIT), an dem er von 1962 bis 1987 auch als Professor lehrte.
Edward N. Lorenz, der Vater der modernen Chaostheorie, wurde am 23. Mai 1917 in West Hartford, Connecticut, geboren. Er studierte zuerst Mathematik und später Meteorologie am Massachusetts Institute of Technology (MIT), wo er von 1962 bis 1987 auch als Professor lehrte. Für seine Arbeiten wurde er 1991 mit dem renommierten Kyoto-Preis und 2004 der Lomonossow-Goldmedaille der Russischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet. Er starb am 16. April 2008 in Cambridge, Massachusetts. mak
In dieser Zeit entwickelte Lorenz ein mathematisches Modell der Atmosphäre, mit dessen Hilfe er die mangelhafte Qualität langfristiger Wetterprognosen verbessern wollte. Für die numerische Lösung seines nichtlinearen Gleichungssystems benutzte er einen Computer, auf dem er die Berechnungen zur Sicherheit zweimal hintereinander durchführte. Zu seinem Erstaunen erhielt er zwei völlig verschiedene Ergebnisse. Anfangs glaubte Lorenz an einen Programmierungsfehler. Doch dann erkannte er den wahren Grund: Beim zweiten Durchlauf hatte er, um Zeit zu sparen, ein Zwischenergebnis eingesetzt und dieses zuvor von sechs auf drei Stellen nach dem Komma gerundet. Dieser winzige Unterschied genügte, damit sich das von ihm modellierte Wetter in gänzlich verschiedene Richtungen entwickelte.
Um die chaotische Dynamik der Atmosphäre zu illustrieren, prägte Lorenz 1972 das oft missverstandene Bild vom Schmetterlingseffekt. Danach können die zarten Flügelschläge eines Schmetterlings in Brasilien letztlich einen Tornado über Texas auslösen. Die Betonung liegt hier auf dem Modalverb »können«. Denn Schmetterlingseffekte beeinflussen die Atmosphäre nur, wenn diese in einen instabilen Zustand gerät. Dann findet eine positive Rückkopplung statt, die dafür sorgt, dass sich kleine Schwankungen der atmosphärischen Bedingungen mit der Zeit unumkehrbar aufschaukeln. Eine Prognose des Wetters ist unter diesen Umständen Glückssache. In stabilen Zuständen hingegen kann ein Schmetterling so viel flattern, wie er will, das Wetter ändert sich dadurch nicht.
Heute wissen wir, dass nicht nur in der Atmosphäre eine chaotische Dynamik schlummert. Chaos herrscht in vielen natürlichen Systemen, genauer gesagt »deterministisches Chaos«. Denn die betreffenden Systeme lassen sich vom Prinzip her exakt beschreiben. Dennoch hängt ihr Verhalten so empfindlich von den Anfangsbedingungen ab, dass es auf lange Sicht nicht prognostizierbar ist. Das gilt schon für die Bewegung dreier Planeten unter dem Einfluss ihrer Gravitation, wie der französische Mathematiker Henri Poincaré im Jahr 1899 feststellte. Und er war entsetzt: »Die Dinge sind so bizarr, dass ich es nicht ertrage, weiter darüber nachzudenken.« Vermutlich ahnte Poincaré, was seit Lorenz unabweisbar geworden ist: Die von der klassischen Mechanik genährte Hoffnung, dass jemand, der die Vergangenheit kennt, daraus die Zukunft ableiten kann, hat sich mit der Entdeckung des deterministischen Chaos als illusorisch erwiesen.
Gleichwohl besteht kein Grund, das Chaos zu dämonisieren. Im Gegenteil. Ohne chaotische Prozesse wäre unsere Welt weniger bunt und vielgestaltig. Denn das Chaos kann auch ein Motor der Kreativität sein, insofern es dynamische Systeme in die Lage versetzt, sich gleichsam von selbst neu zu organisieren. Notwendig dafür ist, dass solche Systeme aus einem stabilen vorübergehend in einen instabilen Zustand übergehen, in dem sich aus zufälligen Schwankungen eine neue Systemordnung herausschälen kann. Wie sagte der Philosoph Friedrich Nietzsche so schön: »Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.«
Heute gibt es unter Wissenschaftlern kaum noch Zweifel, dass in der belebten und unbelebten Natur die Dynamik der Veränderungen häufig eine chaotische ist. Namentlich in Systemen, in denen Evolution stattfindet, bilden chaotische Prozesse häufig den Auftakt zur Selbstorganisation. Inzwischen richten Chaosforscher ihren Blick auch auf die Gesellschaft. Denn dass kleine Ursachen im historischen Verlauf oft große Wirkungen haben, ist eine schwerlich zu bestreitende Tatsache.
»In der Geschichte geschieht unermesslich viel Gleichgültiges«, schrieb Stefan Zweig 1927 in seinem Buch »Sternstunden der Menschheit«, bevor ein einziges Ja oder Nein, ein Zufrüh oder Zuspät den Schicksalslauf eines Volkes oder der ganzen Menschheit nachhaltig verändere.
Bei diesen Worten fühlt man sich unwillkürlich an die Ereignisse in der DDR im Herbst 1989 erinnert. Nach wochenlangen Protesten, die das Land in eine machtpolitische Instabilität geführt hatten, war es ein zu früh ausgesprochener Satz von SED-Politbüromitglied Günter Schabowski, der am 9. November 1989 zur Öffnung der Mauer und damit zum baldigen Zusammenbruch der DDR führte. Ein vergleichsweise singuläres Ereignis hatte den Prozess der demokratischen Erneuerung im Osten Deutschlands, der bis dahin eher zähflüssig verlaufen war und von dem es schien, als würde er Monate oder Jahre in Anspruch nehmen, schlagartig in eine neue Richtung gelenkt.
Kein Historiker oder Politologe hatte dieses Geschehen vorhergesehen. Denn in den Geschichtswissenschaften gebe es keine Tradition des Nachdenkens über Komplexität und keine Theorie, die zur Analyse von sozialen Umbrüchen tauge, meint der Historiker Ludolf Herbst. In seinem Buch »Komplexität und Chaos. Grundzüge einer Theorie der Geschichte« hat Herbst versucht, Erkenntnisse der Chaostheorie für die Beschreibung historischer Verläufe nutzbar zu machen.
Im Allgemeinen stehen solche Versuche unter dem Verdacht des Reduktionismus, da sie erstens auf Analogieschlüssen beruhen und zweitens Begriffe verwenden (Ungleichgewicht, Instabilität etc.), die bisher nur in den Naturwissenschaften brauchbar definiert sind. Gleichwohl ist Herbst überzeugt, dass es soziale Umbrüche gibt, die sich mit den gegenwärtigen Instrumentarien der Revolutions- und Krisentheorie nicht adäquat beschreiben lassen. Eine Chaostheorie historischer Verläufe, die es im Einzelnen freilich noch auszuarbeiten gilt, wäre hier vermutlich eine methodische Bereicherung.
Zum Beispiel um zu erklären, warum das, was Historiker häufig als revolutionäre Situation beschreiben, nicht immer in eine erfolgreiche Revolution mündet. Die Novemberrevolution 1918 in Deutschland wäre hierfür ein Beispiel. Wie sich im Nachhinein herausstellte, waren wichtige politische und militärische Strukturen des Deutschen Reiches soweit stabil geblieben, dass es der Führung der SPD im Bündnis mit der Obersten Heeresleitung gelang, eine erfolgreiche Gegenrevolution in Gang zu setzen. Ob die Machtstrukturen einer Gesellschaft tatsächlich instabil und damit reif für einen Umsturz geworden sind, lässt sich in der Regel nicht theoretisch feststellen, sondern nur dadurch, dass oppositionelle Gruppen versuchen, sie zu verändern. In der Art und Weise, wie der Staat darauf reagiert, offenbart er zugleich die Stabilität seiner Macht und gibt damit anderen das Signal, entweder selbst aktiv zu werden oder sich zurückzuhalten.
Laut Herbst besteht jede Gesellschaft aus dynamischen Systemen, die negativ oder positiv rückgekoppelt sind. Im ersten Fall werden Keime der sozialen Veränderung gedämpft, im zweiten verstärkt, so dass ein chaotischer Prozess einsetzen kann. »Chaos ist das Ergebnis einer Entkopplung von Kräften, denen es gelingt, aus einem negativ rückgekoppelten System auszubrechen.« Eine solche Entkopplung fand offenkundig statt, um bei unserem Beispiel zu bleiben, als die DDR-Führung am 9. Oktober ’89 darauf verzichtete, die Leipziger Montagsdemonstration gewaltsam aufzulösen. Immer mehr Menschen überwanden daraufhin ihre Furcht vor Repressionen und schlossen sich den Protesten an. Ab diesem Zeitpunkt wurde die soziale Entwicklung in der DDR von einer selbst verstärkenden Dynamik getragen. Das heißt, je größer die Zahl der Protestierenden wurde, desto mehr sanken die Hemmschwellen für andere, sich den Protesten anzuschließen. Denn in der Masse bestanden für den Einzelnen geringere Gefahren, zur Zielscheibe von Repressionen zu werden, während die Chancen stiegen, einen Wandel der Verhältnisse herbeizuführen.
Unter instabilen Verhältnissen, so wäre aus der Chaostheorie zu folgern, ist eine gezielte Steuerung sozialer Systeme praktisch nicht möglich. Das gelingt immerhin teilweise in Phasen der Stabilität, in denen negative Rückkopplungsprozesse für eine relative Kontinuität der Entwicklung sorgen. Stabile Verhältnisse haben aber noch einen weiteren Vorzug: Sie versetzen die handelnden Akteure in die Lage, rechtzeitig wirksame Maßnahmen zum künftigen Schutz der Gesellschaft zu ergreifen. Zwar stellen, um hierfür ein Beispiel zu geben, rechtsextreme Parteien in Zeiten politischer Stabilität keine akute Gefahr für die Existenz eines demokratischen Systems dar. Unter instabilen Bedingungen allerdings können solche Parteien rasch Masseneinfluss gewinnen. Man denke etwa an die Endphase der Weimarer Republik. Umso wichtiger ist es, bereits in stabilen Zeiten eine Politik zu betreiben, die sich der Ausbreitung des Rechtsextremismus konsequent verweigert. Denn keine Gesellschaft, so lehrt die Geschichte, vermag ihre Stabilität auf Dauer zu bewahren. Mit einem Wort: Das nächste Chaos kommt bestimmt. Und niemand kann vorhersagen, welche sozialen Bewegungen es entfesseln wird.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.