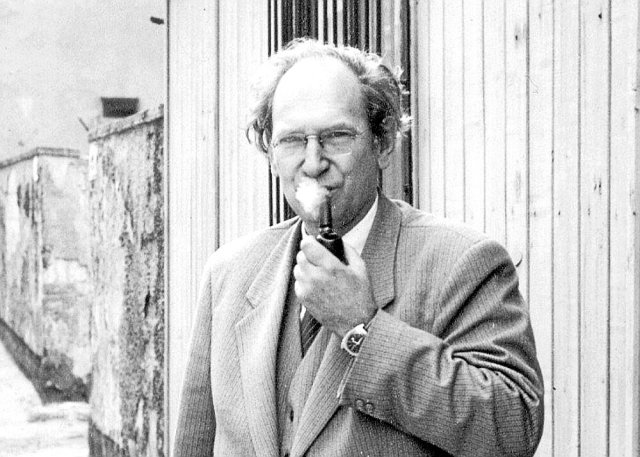Ein britisches Programm
Michael Francis dirigierte in der Philharmonie Werke von Haydn, Ives, Britten und Williams
Dass ein Brite gern britische Musik spielt, wer würde es ihm verdenken? Michael Francis - er dirigierte erstmals das Rundfunk-Sinfonieorchester - ist Brite. Eleganter Mann, ehrgeizig, von hoher Musikalität, obendrein international renommiert. Er brachte gleich ein ganzes englisches Programm mit.
Joseph Haydns Sinfonie Nr. 104 D-Dur, sie eröffnete den Abend, gehört dazu. Haydn liebte England und das englische Publikum. Mehrmals hielt er sich dort länger auf, trank mit seinen Konzertagenten, unterschrieb die besten Kontrakte, genoss den Jubel, der in großen Hallen seinen Londoner Sinfonien entgegenschlug, aufgeführt von bis zu 60 Musikern, was Höfe und Kirchen auf dem Festland kaum leisten konnten. Die Verfügenden ließen sich das etwas kosten, sodass der Komponist dort in wenigen Wochen das Zehnfache dessen verdiente, was ihm sein Dienstherr Fürst Esterházy im ganzen Jahr an Gulden zahlte.
Neben dem unsterblichen Haydn der große Benjamin Britten mit einem bedeutenden Stück für Viola und Streicher, einer Art Ode auf die Nacht, getitelt mit »Lachrymae«. Weitere englische Figur der unterdes wieder fast vergessene Charles Ives (1874 - 1954), US-Amerikaner, von Beruf Unternehmer - er betrieb eine gut gehende Versicherungsfirma -, ein Mann mit englischen Urwurzeln und der nimmermüden Neigung, sich an Philosophen wie Emerson und Thoreau ein Beispiel zu nehmen. Von Ives kam »The Unanswered Question« für Trompete, vier Flöten und Streicher. Schließlich als kompaktes Finalstück die 6. Sinfonie des Briten Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958).
Von den zwölf Londoner Sinfonien Haydns zeigen einige, wenn nicht alle, wie viel Mozart von seinem Vorbild gelernt hat. Klassischer Geist waltet darin und öffnet den Blick. Besagte Nr. 104 beginnt mit einem akkordisch eingefassten Adagio, was seinerzeit überraschte, weil es aus der Norm fiel. Neuerer ist Haydn auch im zweiten Satz Andante. Der lädt zu kreativer Ausdeutung geradezu ein. Michael Francis brachte mit den Berliner Musikerinnen und Musikern besonders diesen Satz höchst kunstvoll zum Blühen. Die Tempi retardieren im periodischen Taktgefüge. Hohen Wert erhalten die Pausen, nicht minder die sensitiven Verschiebungen der Laut-leise-Verhältnisse. Der dritte Satz, »Menuett. Allegro«, ein rondoförmiges Gebilde, läuft nicht, wie gewöhnlich, rein klassisch ab, sondern Haydn hat darin Löcher gesetzt, aus denen kurzzeitige dramatische Pulse hervorspringen. Solche Einfälle, von Francis genauestens beleuchtet, weisen schon auf Beethoven.
Brittens »Lachrymae« (Tränen) besetzt Sphären einer vollkommen anderen Welt. Im Untertitel steht »Reflexionen über ein Lied von John Dowland für Viola und Klavier«. An sich ein Frühwerk, dem sich der Komponist viel später noch einmal zuwandte, um es aus der Kammer in den sinfonischen Raum zu führen. An die Stelle des Klavierparts setzte er ein Streichorchester, freilich nicht eins zu eins. Entstanden ist eine andere Komposition. Britten, mit dem Piano ohnehin verschwistert, ist auch mit der Viola groß geworden, er hat sie gern und oft auch solistisch eingesetzt wegen ihrer sonor-rauchigen, dunkle, schmerzliche Affekte aufrufenden Färbungen.
»Lachrymae« ist ein Musikstück von seltener Empfindlichkeit. Die Zahl 12 ist darin Teil der musikalischen Verfasstheit. Das Stück strukturiert zwölf jeweils bezeichnete »Reflexionen« und gebietet souverän über alle zwölf Töne der chromatischen Skala. Der Eingangsteil Lento etwa klingt, als grüße er den »Farben«-Satz von Schönbergs op. 16 (Fünf Orchesterstücke). Dass Michael Francis jenes Viola-Konzert in die Philharmonie trug, beste Streicher und mit Hwayoon Lee aus Südkorea eine erstklassige Viola-Solistin zur Verfügung hatte, ist Glücksmoment. »Lachrymae« bedient variativ alle Merkmale des klassischen Konzertierens und untergräbt dieselben zugleich. Die Violastimme sucht dem Abtausch, der Umgarnung zu entgehen, sie flieht den fahlen, düsteren Einflüsterungen der Streicher und will zugleich die sie bedrängenden Nachtgeister von sich stoßen. Bei Letzterem wechseln die Stimmungen heftig. Erst am Schluss erscheint eindrücklich klar die Melodie »If my complaints could Passions move« von John Dowland.
Charles Ives’ achtminütige »Unanswered Question« disponierte Michael Francis als Raummusik. Ganz oben die mehrmals wie der Rufer in der Wüste Signale von sich gebende Trompete, in der Mitte unten die ihren Klangteppich webende Streichergruppe, mit dem Rücken zu ihr der Dirigent, vor ihm erhöht das mehrmals in kurzen Schüben querulierende Flöten-Quartett. Diese Horizontale spaltet gleichsam den Saal und bildet drei stufige Inseln, die ganz Verschiedenes absenden. Wunderbar anzuhören.
Ralph Vaughan Williams’ 6. Sinfonie, entstanden 1944 - 48, hat in der Mitte einen gedehnten, wüst belfernden Marsch, der das halbstündige, viersätzige Gebilde fast erschlägt. Das Werk - die Nazis indizierten alle Williams-Musik - gelangte 1948 zur Uraufführung. An die 100 Wiedergaben erlebte es damals in nur zwei Jahren. Interessant ist die Holzbläser-Episode nach dem abschwellenden Marcato-Abschnitt. Sie hat nur wenige Takte. Dort wird plötzlich laut, was unter Avantgardisten als modern galt. Die Tonalität ist aufgehoben, Motive zerfetzen, die Töne klettern wie erregte Schimpansen an Drahtzäunen, eckig, listig. Williams gibt an dieser Stelle seiner Musik wirklichen Schneid. Michael Francis dirigierte, synchron mit dem großen RSB-Aufgebot, seinen Landsmann voll Hingabe.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.