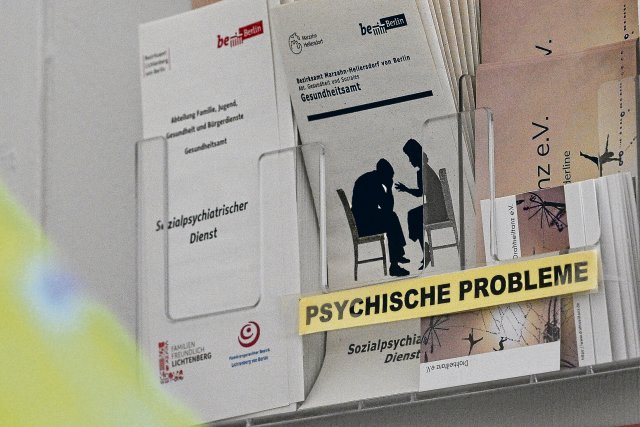- Berlin
- Folgen der Dürre
Warten auf den Landregen
Seit Monaten hält Wasser aus umliegenden Talsperren die Spree in Bewegung.
Auf den ersten Blick sieht man der Spree ihre Not gar nicht an, wenn sie die südliche Stadtgrenze Berlins passiert. Der Boots- und Schiffsverkehr auf den Gewässern der Hauptstadt scheint für die Jahreszeit normal zu laufen. Und es regnet ja sogar hin und wieder.
Doch der Fluss, der nicht nur von großer Bedeutung für die Trinkwasserversorgung von Berlin und Frankfurt (Oder) ist, leidet so wie alle anderen Gewässer in der Region auch unter Niedrigwasser. Seit Monaten quält sich die Spree aus ihrem sächsischen Quellgebiet im Lausitzer Bergland gen Norden. Am Fließen gehalten wird sie durch die Einspeisung großer Wassermengen aus Talsperren wie Quitzdorf und Bärwalde sowie dem Speicherbecken Lohsa II in Sachsen und der Talsperre Spremberg in Südbrandenburg. Dass dies bei der trotz des einsetzenden Wetterwechsels beispiellosen Trockenheit bis heute funktioniert, liegt am ausgeklügelten Wassermanagement, das von den Ländern Brandenburg, Sachsen und Berlin sowie den Tagebauunternehmen Leag und LMBV gemeinsam überwacht wird.
Wie schlimm sich die Situation in den Augen Außenstehender in den vergangenen Wochen auch darstellte - Kurt Augustin, der zuständige Abteilungsleiter Wasser und Bodennutzung im Potsdamer Umweltministerium, schien nichts zu erschüttern. Als im September die südlichen Landkreise und Cottbus wegen der Trockenheit die Wasserentnahme aus Flüssen und Seen reglementierten und der Pegel der Talsperre Spremberg bedenklich sank, versicherte er: Wir haben genügend Wasserreserven für die Spree, die Trinkwasserversorgung von Berlin und Frankfurt ist jederzeit gesichert, die Wasserqualität stimmt.
»Wenn es in den kommenden drei Wochen jeden Tag so regnet wie zu Wochenbeginn, dann wäre die Welt wieder in Ordnung und wir hätten die Niedrigwasserperiode halbwegs überstanden. Wir bräuchten einen richtigen Landregen«, sagte Augustin in dieser Woche dem »nd«. Tage zuvor hatte es Aufregung gegeben, hatten Medien unter Bezugnahme auf die Berliner Umweltverwaltung gemeldet, die Spree fließe wegen Wassermangels jetzt rückwärts und drohe, trocken zu fallen, bald würden die Schleusen geschlossen und die Schifffahrt eingestellt.
»So weit sind wir bei weitem nicht«, stellte der Gewässerfachmann klar. Erst am Montag hatte sich Augustin von der alle zwei Wochen tagenden Expertengruppe aus Vertretern Brandenburgs, Sachsen und vom Bund auf den aktuellen Stand bringen lassen. Sein Fazit lautete: »Die Situation ist zwar angespannt, aber wir haben noch insgesamt rund sechs Millionen Kubikmeter Wasser in dem Speichersystem, um die Spree auch in den kommenden Wochen stärken zu können.« Nach seiner Einschätzung verfügt allein Spremberg noch immer über Reserven von 2,2 Millionen Kubikmeter. Bis man die aufgebraucht habe, bleibe der Pegel der Talsperre über der besorgniserregenden Marke von 90 Metern über Normalnull (NN). Auch der Mindestabfluss der Spree von 2,5 Kubikmeter pro Sekunde (m3/s) am Zulauf der Talsperre werde gehalten.
Eine beruhigende Botschaft richtete Augustin an die Berliner und Frankfurter: »Wir haben keine Probleme mit der Trinkwasserversorgung.« Das betreffe vor allem auch die Qualität des Wassers, das ja eine Eisen- und Sulfatfracht - Altlasten des Braunkohletagebaus in der Lausitz - mit sich führt.
»Generell haben wir dank des infolge der Trockenheit gesunkenen Grundwasserspiegels in diesem Jahr eher geringere Probleme mit Eisenoxid und Sulfatsalz, die sich ja erst bei Kontakt mit Wasser aus dem Erdreich lösen und in die Gewässer abfließen«, so Kurt Augustin. Eisenoxid, als Eisenocker für die südlich des Spreewalds häufig zu beobachtende Braunfärbung unter anderem der Spree verantwortlich, ist für den Menschen eher unbedenklich, kann allerdings die Lebensräume von im Wasser lebenden Pflanzen und Tiere schädigen. Ein Großteil der Eisenockerfracht der Spree wird vor Spremberg in der Vorsperre Bühlow durch Bekaltkung zum Ausfällen gebracht. Der sich in großen Mengen absetzende Schlamm muss allerdings regelmäßig ausgebaggert und deponiert werden.
Probleme für den Menschen könnten sich aus einer erhöhten Sulfatkonzentration im Trinkwasser ergeben, der zulässige Maximalwert wurde auf 250 Milligramm pro Liter (mg/l) Wasser festgelegt. Dieser Wert werde in den Wasserwerken durch einen Mix aus Oberflächen- und unbelastetem Oberflächenwasser zuverlässig erreicht, so Augustin. Dafür dürfe die Spree an den Messstellen Rahnsdorf (für Berlin) und Briesen/ Neubrück (für Frankfurt) maximal 230 mg/l beziehungsweise 280 mg/l mit sich führen. Und das sei gewährleistet.
Brandenburg und auch Sachsen arbeiten an der Verbesserung der Qualität des Spreewassers. Das Umweltministerium in Potsdam hat dem Wirtschaftsministerium verbindliche Zielwerte für die Eisen- und Sulfatkonzentrationen zur Abstimmung vorgelegt. Entsprechende Erlasse sollen künftig den Wasserbehörden im Land als Arbeitsgrundlage dienen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.