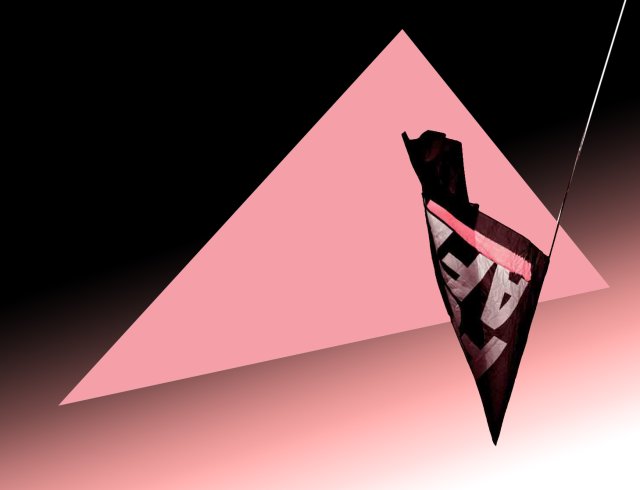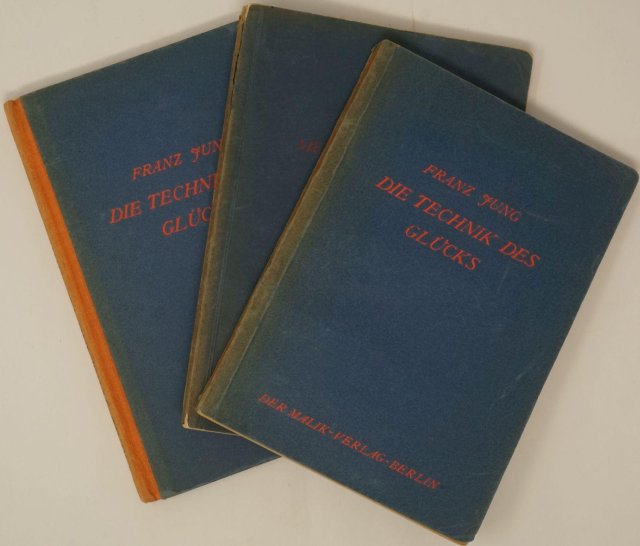- Kultur
- Reportage - Samoa
Am Grabe des »Tusitala«
Samoa, wo der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson starb, ist nicht die in seinem berühmten Abenteuerroman beschriebene »Schatzinsel«
Danach kann der Aufstieg auf den etwa 500 Meter hohen Mt. Vaea in Angriff genommen werden. Auf seinem Gipfel, umgeben von prächtig blühenden Robinien, befindet sich der Sarkophag des am 3. Dezember 1894 verstorbenen schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson. Sein Abenteuerroman »Die Schatzinsel« (die nicht im Pazifik lag) und später die Kriminalstory »Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde« und die Erzählung »Das Flaschenteufelchen« machten ihn weltberühmt. Seine Geschichten aus der Südsee blieben hingegen etwas für Liebhaber der Inselwelt.
»Hier liegt er, wo er hingehört«
Der Pfad, auf dem die samoanischen Häuptlinge einst ihren geliebten »Tusitala« (Geschichtenerzähler) zur letzten Ruhe auf den Berg getragen hatten, windet sich durch dichten Regenwald. Fikus- und Pandanusbäume, hier und da ein Hibiskusstrauch, eine Palme oder eine rot blühende Ingwerpflanze, die Nationalblume der Samoaner, säumen den Weg. Etwas beschwerlich wird die Tour wegen der hohen Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen über 30 Grad, und weil die Zeit drängt. Auf dem Rückweg ist nämlich noch ein Abstecher zur Villa Vailima vorgesehen, Stevensons Residenz während seines fünfjährigen Inselaufenthalts. Nach 25 Minuten aber ist das Ziel erreicht - der Gipfel des Mt. Vaea. Ihn krönt die Grabstätte aus weißem Stein. Auch Stevensons Frau Fanny wurde hier beigesetzt. Auf einer Metalltafel steht in Englisch ein Vers, den der Schriftsteller geschrieben und sich als Epitaph gewünscht hatte:
Unter dem weiten von Sternen
übersäten Himmel
Schaufelt mein Grab
und bettet mich zur Ruh
Glücklich lebte ich und
glücklich starb ich
Und ich legte mich nieder
mit dem Wunsch
Dies sei der Vers,
den ihr für mich eingraviert:
Hier liegt er, wo er hingehört
Zurück ist der Seemann
von der See
Und der Jäger zurück vom Berg.
Von hier oben schweift der Blick weit über die Insel Upolu, linker Hand bis zum Pazifik, rechter Hand auf höhere, ebenfalls bewaldete Berge.
Am Fuße des Mt. Vaea liegt die Villa Vailima auf eionem ausgedehnten, von fünf Bächen durchzogenen Anwesen mit »Wasserfällen, Abstürzen, Schluchten, fruchtbaren Flächen und Wiesen«, wie es der Stevenson begeistert beschrieb. Hier wollte der Lungenkranke in einem Klima, das ihm wohltat, und unter Menschen, die er sehr mochte, den Rest des Lebens verbringen.
Das heutige Museum stellt einiges aus dem persönlichen Besitz der Familie Stevenson, Hausrat und Mobiliar sowie einen Teil der Bibliothek des Schriftstellers aus. Der Besucher erfährt eine Menge Einzelheiten aus dem Leben des berühmten, am 13. November 1850 in Edinburgh geborenen Schotten. In seiner Wahlheimat war er kein Beobachter aus der Ferne, sondern lauschte aufmerksam den spannenden Erzählungen, den Legenden von der Feuergöttin Pele und dem Meeresgott Kamaloa, der Mythologie der Eingeborenen, deren Vertrauen und Respekt er gewann. Er schloss Freundschaften und wurde in die samoanische Gesellschaft aufgenommen. Er zeigte Verständnis für den Freiheitsdrang der Samoaner, die unter dem kolonialen »Schutz« Deutschlands, der USA und Großbritanniens standen und mit der Mau-Bewegung dagegen aufbegehrten. Der enge Kontakt zu den Insulanern ermöglichte dem »Tusitala« Blicke hinter die Kulissen und versetzte ihn in die Lage, in seinen Südsee-Geschichten gesellschaftliche Strukturen, exotische Feste, Bräuche und Begräbnisse zu beschreiben, Tabus, Tatoos und Kannibalismus zu erklären, ohne mit dem europäischen Zeigefinger oder gar mit der Faust zu drohen.
Dass die Häuptlinge ihn als einen der Ihren betrachteten, beweist der Bau einer Straße zur Villa Vailima, den sie mit eigenen Händen bewerkstelligten. Als diese »Straße der liebenden Herzen« eingeweiht wurde, erkärte Stevenson: »Ich liebe Samoa und sein Volk. Ich liebe das Land. Ich habe es zu meiner Heimat gewählt, solange ich lebe, und zu meinem Grab nach meinem Tode. Ich liebe die Menschen und habe sie zu meinen Landsleuten gewählt, um mit ihnen zu leben und mit ihnen zu sterben. Und ich sehe, dass der Tag des großen Kampfes jetzt kommt, der großen und letzten Möglichkeit, mit der entschieden wird, ob ihr wie die anderen Rassen, von denen ich spreche, aussterben werdet, oder ob ihr standhaft bleibt und eure Kinder fortleben und euer Andenken wahren in dem Land, das ihr von euren Vätern übernommen habt.« Kein Wunder, dass die Samoaner dem toten »Tusitala« mit einer Zeremonie, wie sie nur Stammesfürsten zustand, die letzte Ehre erwiesen.
Auf deutsche Spuren trifft der Besucher noch immer auf Samoa. Die Landeswährung heißt Tala, abgeleitet vom Taler. In Apia stößt er auf das deutsche Denkmal, das deutsche Flaggenmonument und auf ein Hotel namens »Insel Fehmarn«. Der Tourismus-Minister, der Samoa natürlich als »Inseln der Schönheit, der Sonne, des Sandes und des Meeres« preist, heißt Hans Joachim Keil. Die Goldfische im Teich von Lanotoo wurden einst aus Deutschland importiert und von deutschen Siedlern ausgesetzt. Und etliche der Plantagen stammen aus der Kolonialzeit. Wie Meyers Konversationslexikon von 1897 verrät, hatte die deutsche Handels- und Plantagengesellschaft 54 000 Hektar Land in Besitz genommen und darauf Kokospalmen und Bananenstauden pflanzen, Baumwolle, Kaffee, Pfeffer und Mais anbauen lassen.
Nachdem ihre Kriegsschiffe mit Ausnahme der englischen »Calliope« im Hafen von Apia durch einen Wirbelsturm versenkt worden waren, einigten sich Deutschland, die USA und Großbritannien auf der Berliner Samoa-Konferenz am 14. Juni 1889 über die Aufteilung der reizvollen, reichen und strategisch bedeutsamen Inseln. Den östlichen Teil erhielten die USA, heute Amerikanisch Samoa. Ans Kaiserreich ging Westsamoa, das nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Unabhängigkeitserklärung 1962 unter neuseeländischer Verwaltung stand und seit 1997 die offizielle Bezeichnung Samoa trägt. London gab sich mit Tonga, den Salomonen und anderen Südseeinseln zufrieden.
In den Hafen von Apia liefen im Jahre 1894 immerhin 116 deutsche Schiffe ein, was nur belegt, wie lukrativ das Samoa-Geschäft und wie intensiv die koloniale Ausplünderung waren.
Den Gesang liefert heute das Radio
Heute gehört der Inselstaat, der ganze 2842 Quadratkilometer Landfläche aufweist, mit wirtschaftlichen Wachstumsraten von etwas über vier Prozent zu den prosperierenden Ländern der Pazifikregion. Premier Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, seit neun Jahren am Ruder, gelang es, die Regierung, die einflussreiche Kirche (80 Prozent der etwa 180 000 Insulaner sind Protestanten, 20 Prozent Katholiken) und die traditionellen Autoritäten, Häuptlinge und Clanchefs zu einer ersprießlichen Kooperation zu bewegen.
Während Mark Twain, Jack London, Herman Melville, Paul Gauguin und viele andere nach ihren Besuchen in der Südsee die Inselwelt als paradiesisch darstellten, von der unberührten Natur und lieblichen Menschen schwärmten, hielt sich der »Tusitala« in dieser Hinsicht auffällig zurück. Doch er schrieb von »unablässigem Gesang. Der Bootsführer singt am Ruder, die Familie bei der Abendandacht, die Mädchen singen nachts im Gästehaus und manchmal singt der Arbeiter bei seiner Beschäftigung.« Das Paradies sucht man auf Samoa heute vergeblich. Und auch der Taxifahrer singt bei der Rückkehr ins Hotel nicht vor sich hin. Aus seinem Radio plärrt stattdessen laute Schlagermusik.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.