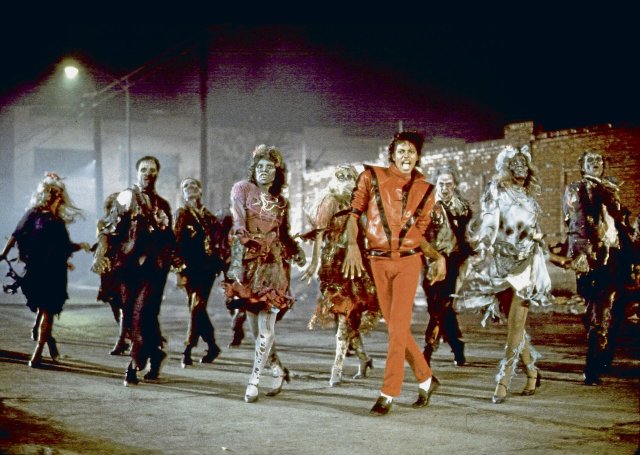- Kultur
- Ausstellung »Isa Genzken: 75/75«
Architektur und Albtraum
Zum 75. von Isa Genzken zeigt die Neue Nationalgalerie Berlin 75 ihrer Skulpturen – ein wenig hat das was von Heimwerkermarkt

Isa Genzkens riesige Rose vor ihrer Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie wirft beim Familienausflug Fragen auf. »Die Rose – ist das nicht ein Symbol der Liebe?« »Doch, schon.« »Warum steht sie dann vor diesem zweckfreien Zweckbau von Ludwig Mies van der Rohe?« Damit, liebes Kind, hat es folgende Bewandtnis: 1988 beteiligte sich die Künstlerin an einem Wettbewerb der Stadt Amsterdam. Sie schlug vor, links und rechts der Autobahn 30 Meter hohe Tulpen aus Aluminium aufzustellen. »Da hätten die Leute, die da entlangfahren, gewusst: Jetzt sind wir in Holland«, wie Genzken erläutert. Die Tulpen wären also das gewesen, was wir Kunstkritikerinnen »ortsspezifisch« nennen.
Doch den Holländern war das zu witzig und zu teuer. Deshalb entschloss sich Genzken zu einem absolut ortsunspezifischen Werk, eben zu der Rose. Sie stellte das Symbol der Liebe überall da auf, wo es garantiert keine Liebe gibt, also in Baden-Baden, New York, Paris und nun auch in unserem hartherzigen Berlin. Und um letzte Bedenken auszuräumen, ob das nicht doch irgendwie an Jeff Koons erinnert, sei auf »Fuck the Bauhaus 2« (2000) verwiesen. Dieses fantastische Architekturmodell aus Alltagsabfall wie Pizzapackung und Plastikschrott zeigt an einer Fassade die Versandbox eines Blumenladens: Zwei weiße Rosen ragen skulptural in die Höhe. Ich wiederhole: zwei. Auf dem Dach wachsen unter einem Drahtgeflecht (entsprechend der Größenverhältnisse) monströse Plastikblumen. Vor diesem bizarren Entwurf für ein »Haus in New York« finden sich Bäumchen und Männchen wie bei einem gewöhnlichen Architekturmodell.
Die futuristischen Pläne des Städtebaus – ein Müll-Konglomerat. Es ist schwer, das nicht politisch aufzufassen, und zwar in zweierlei Hinsicht: Diese Stadt-Visionen beschreiben einerseits die im Müll ertrinkende Metropole der spätkapitalistischen Epoche, sie nehmen andererseits viel vom kühn Zusammengebastelten der Slum-Bauten von Migranten und Obdachlosen in sich auf.
Mit dem Irak-Krieg 2003 tritt noch ein unheimliches Moment hinzu, Architektur und Albtraum amalgamieren. In »Empire/Vampire. Who Kills Death« (2003) sind aus Modellen Dioramen ohne dazugehörige Kästen geworden, sie versetzen uns in einen Godzilla-Film ohne Godzilla (es sei denn, Godzilla sind wir selbst). Wir sehen Superhelden, Soldaten, Verbrannte oder auch Abgesoffene in einem Trinkglas (wiederum als hochhausgroßes durchsichtiges Gebäude vorzustellen), oft blutrot oder giftgrün angesprüht.
Die Horrorshow setzt sich 2005 mit »Kinder filmen« fort. Der Titel bezieht sich auf die Schlagzeile eines Boulevardblatts: »Grausamer Handy-Trend – Kinder filmen«. Schülerinnen und Schüler haben sich – gewissermaßen als kleine Lynndie Englands – dabei gefilmt, wie sie andere folterten. Von diesen Schrecken ist bei Genzken nichts zu sehen. Aber bei ihr ist es viel schrecklicher, weil wir uns die Schrecken ausmalen müssen: Mit Folie versiegelte Stapelstühle scheinen aus der Asservatenkammer zu stammen. Andere, in Berlin nicht zu sehende Werke dieser Jahre beinhalten bespritzte Spielzeuge und verformte Puppen. Ein Jahr später nimmt sie wiederholt Rollstühle in ihre Installationen auf. Kurz: Die Bluttaten, wie immer sie verlaufen sein mögen, sind bereits geschehen; manche Beteiligte werden tot, andere verkrüppelt sein. Wenn das Kinderzimmer zur Folterkammer wird, denkt eine (oder einer) unwillkürlich an Mike Kelley, aber Genzken ist zugleich subtiler und kaputter. Sie ist dies aber nur diese eine Dekade lang, von 2000 bis 2010, vorher und nachher macht sie anderes.
Völlig anders als alles Spätere sind ihre Skulpturen aus den Siebzigern, die Ellipsoide und Hyperboloide, mit denen sie in die öde Blockwelt des Minimalismus vorstieß. Die ungewöhnlich fein gekrümmten, sich wie Spieße streckenden Formen von bis fünf Metern Länge ließ sie sich von einem Physiker berechnen, drechselte sie aus Holz und lackierte sie dann. Liegen sie in einem leeren Saal, haben sie eine elegante, erhaben-sinnlose Anmutung. Genau diese wollten die Berliner Kuratoren – Klaus Biesenbach und Lisa Botti – anscheinend vermeiden und legten zwei Ellipsoide und zwei Hyperboloide dicht an dicht, als wären es Bretter auf der Baustelle, die noch verbaut werden müssen. Überhaupt hat ihre Präsentation etwas von einem Schaulager oder einem Heimwerkermarkt. Skulptur steht neben Skulptur.
Die Kuratoren versprechen sich von der Werkserie der »Fenster«, dass sie einen »einzigartigen Dialog mit der Architektur Mies van der Rohes entfalten«. Gut zu wissen. Wer sich vor diese »Fenster« – nach 1990 entstandene Rahmen aus Beton, Stahl, Epoxidharz – stellt, kann durch sie und die Panoramascheiben des Museums hindurch zwar nicht viel Mies, aber beispielsweise das Marriott-Hotel und die Bibliothek des Wissenschaftszentrums erkennen, meistens sieht man aber andere Besucherinnen und Besucher und vor allem andere Skulpturen.
Interessanter ist ohnehin der Blick nach oben. Es hängen recht seltsame Objekte herab. Da ist der nicht umsonst »Mies« (2008) genannte berühmte Barcelona-Sessel des Meisters mit runtergerutschtem Polster, umgedreht und mit bunten Plastikreifen verschönert, daneben Äste und Krepp-Papier. Das könnte tatsächlich ein »Dialog« sein, im Stil des Streitgesprächs, wenn auch nicht mit Miesens Architektur, sondern mit seinem Möbeldesign. Und dann hängt da eine Kühlerhaube, auf die unter anderem »USA« gesprüht ist (»ohne Titel«, 2018); USA und Isa – sieht nach einem Konflikt aus.
Unter den jüngeren Werken fällt eine bearbeitete Nofretete mit Atemmaske auf. Reflektiert das auf Corona? Nein, die Büste stammt aus dem Jahr 2015. Es scheint, dass Künstlerinnen mit dem bösen Blick wie Isa Genzken mitunter Katastrophen vorwegnehmen, von denen wir noch nichts ahnen.
»Isa Genzken: 75/75«, bis zum 27. November, Neue Nationalgalerie, Berlin
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.