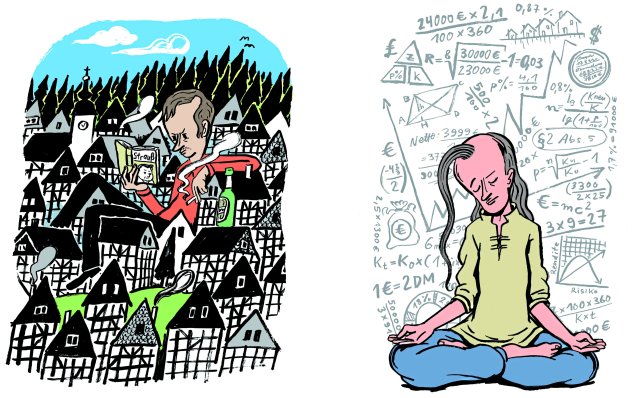- Kultur
- Fashion
Zwischen Atlasseide und Nylon
Das Schloss Meyenburg in Brandenburg beherbergt eine der weltweit größten Privatsammlungen historischer Kleidung – eine aktuelle Schau zeigt Bademode

Endlos weit der Himmel, eine Stille, die man hören kann, und steinerne Gemäuer mit langer Geschichte: das Schloss Meyenburg im Land Brandenburg. Ein ehemaliger Adelssitz der Familie von Rohr, der heute vor allem als Modemuseum genutzt wird. Auf mehr als 1000 Quadratmetern beherbergt das Schloss eine der größten privaten Modesammlungen. Dazu zählen Kleider, Mäntel, Schuhe, Schals, Hüte, Schmuck, Handtaschen und vieles mehr.
Die umfangreiche Sammlung des Modemuseums verdankt Meyenburg Josefine Edle von Krepl. Die Modedesignerin und Modejournalistin, deren Familie es durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs von Wien nach Fürstenwalde verschlagen hatte, nähte sich bereits während ihrer Oberschulzeit Kleider. Angefangen hatte alles mit einem schwarzen Seidenkleid aus den 1930er Jahren, ein Geschenk ihrer Großmutter. Dieses Kleid und ebenso das raffiniert geraffte Brautkleid ihrer Mutter waren für die damals erst 14-Jährige Auslöser einer Leidenschaft, die bis heute anhält. Schon als sehr junge Frau begann Edle von Krepl, getragene Kleidung des 20. Jahrhunderts zu sammeln. Dreizehn Jahre lang arbeitete sie als Redakteurin für die DDR-Frauenzeitschrift »Für Dich«. Bereits in den 1980er Jahren eröffnete sie in Berlin-Friedrichshain eine der wenigen privaten Modeboutiquen in der DDR, in der sie ihre eigenen extravaganten Entwürfe erfolgreich unter dem Label »Josefine« verkaufte. 1989 zog sie nach West-Berlin und übernahm den Antikmodeladen »Falbala«, mit dem sie 1996 nach Ost-Berlin an den Kollwitzplatz umzog.
Josefine Edle von Krepl ist eine Frau mit einem langen Atem. Sie hatte eine Vision. Kontinuierlich erweiterte sie ihren Fundus und erfüllte sich schließlich einen lang gehegten Traum. Auf Schloss Meyenburg eröffnete sie 2006 das mittlerweile renommierte Modemuseum.
Über ein paar Stufen hinab in den Keller betreten die Besucher eine vergangene Welt mit exklusiver Garderobe aus der Zeit um 1900. Es folgen Kleider aus den nachfolgenden Jahrzehnten bis in die 1970er Jahre. Wunderschöne, elegant arrangierte Kleider, hinzugefügt zahlreiche Handtaschen, Ketten, Broschen, Sonnenschirme, Stühle, Koffer oder Fotos. Modisches Zubehör, das die Besucher sofort umwirbt, schmeichelt, verzaubert.
Ein Grammofon spielt Lieder von der Jahrhundertwende – und erzeugt damit eine Atmosphäre, in der man sich vorstellen mag, auf Wiener Opernbällen Damenroben mit Rüschen und Spitzen auszuführen, dazu Hüte und Capes, Fächer und perlenbestickte Täschchen. Mittendrin zeitgemäß feines Porzellan, Gläser und andere Alltagsgegenstände. Hochzeitsschuhe mit geschwungenen Absätzen und einer seitlichen Knopfreihe aus Ziegenleder. Weiße Leinenwäsche, Nachthemden mit Kragen aus Spitze. Schwere schwarze Wollmäntel für die Herren, frivole Kleider der Charleston-Ära, Petticoats, die ersten sportlichen kurzen Hosen aus den 1920er Jahren, opulente Brokatroben aus den 1950er und 1960er Jahren und schließlich geblümte Hippie-Mode. Zu allen Epochen werden die passenden Accessoires, aber auch Möbel präsentiert.
Die zeitgenössischen Melodien im Raum wechseln, die Kleider werden kürzer, mit Pailletten besetzt, die Muster größer, die Stoffe pflegeleichter. Accessoires und ausgewählte Ausstattungsgegenstände vervollständigen die auf alten Schneider- und Schaufensterpuppen drapierten und in Szene gesetzten Kleidungsstücke. Drumherum Werbeplakate, Modezeichnungen, originale Fotos, Kataloge, Schallplatten, Radios, Zigarettenschachteln, Bilderbücher und Tafeln, die zeitgeschichtliche Ereignisse in Kultur, Politik und Gesellschaft dokumentieren. Die mehrere Tausend Exponate umfassende Ausstellung erinnert die Besucherinnen und Besucher sicher auch an die eigenen Vorfahren, wie ähnlich die Großmutter, der Opa oder die Eltern auf alten Familienfotos gekleidet waren – oder auch sie selbst noch als Kinder und Jugendliche. Fantasie und Improvisationstalent waren gefragt.
Josefine Edle von Krepl sammelt bereits über ein halbes Jahrhundert Mode. Sie hat sich nicht beirren lassen trotz vieler Lacher und Lästerer. »Man muss Träume haben – aber auch viel Kraft, sie zu verwirklichen. Ich wusste: Ich mache das. Ich rette und bewahre schöne Kleider und eines Tages werde ich sie zeigen. Doch der Anfang ist immer schwer. Und ich kam ja hier in eine Gegend, die von Textilien und noch dazu von historischen Textilien unberührt war.«
Die Modeliebhaberin sammelt nicht nur alte Kleider, sie spürt mit ihnen auch verschiedenste Zeitschichten auf, Geschichten von Menschen, ihren Nöten und Sehnsüchten. Nach und nach konnte sie zeigen, was alles hinter den Kleidern und der jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklung steckt. »Früher war sich anzuziehen gesellschaftlich reglementierter. Es gab Sonntagskleider, Kirchgangskleider, Alltagskleider, Sommerkleider sowie Festkleider, die den Glanz und Glamour der jeweiligen Zeit zeigen.« Im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach allerdings waren Stoffe und Kleidung Mangelware. So entstanden durch Veränderungen und Umnutzungen die sogenannten Notkleider. Sie sind Edle von Krepl die liebsten. Berührend sind die Geschichten einzelner Stücke, die sie vor dem Vergessen gerettet hat. Wie die jenes Hochzeitskleides aus feinem Baumwolltüll mit Perlenstickerei, welches eine junge Frau 1917 in Hannover mit einem gelben Unterrock zu ihrer Verlobung trug. Sie wollte es zu ihrer Hochzeit tragen. Doch dazu kam es nicht. Ihr Verlobter kehrte nicht aus dem Krieg zurück.
Die Kleider fand die Modeenthusiastin auf Dachböden, in alten, lange verschlossenen Truhen. Manche von ihnen waren nur Fragmente, andere blieben komplett erhalten, wenn auch verschmutzt und mit Spinnweben durchzogen. Eines hat sie auch in Meyenburg gefunden und vor dem Verfall gerettet. »Fräulein Marie Willebald wohnte um die Jahrhundertwende hier in Meyenburg, Marktstraße Nummer 17. Das ist alles belegt. Von ihr gibt es ein schönes Hochzeitskleid. Sie hat, nein, sie wurde im Jahr 1907 vom Schuldirektor Schulz geheiratet. Das Kleid besteht aus schwerer Atlasseide mit Spitzenbesatz«, erzählt Edle von Krepl. »Man ahnt: Entweder hat die Familie lange gespart oder sie war vermögend.«
Zur Dauerausstellung hinzu kommt gerade eine Schau über historische Bademode. Der bekannteste Bademodensammler Deutschlands, Jürgen Kraft von der Insel Usedom, hat seine Exponate an das Meyenburger Museum verliehen. Hier kann man auch etwas über die historische Genese von Schwimmbekleidung lernen. Etwa, dass Strick erst in den 1930er Jahren durch Baumwolle ersetzt wurde. Später verwendete man synthetische Funktionstextilien wie Lycra und Nylon, und die Designs veränderten sich mit: Badeanzüge und Bikinis waren nun durch ihr dehnbares Material am Körper knapper und eng anliegender als zuvor. Auch wenn die Badesaison sich gegenwärtig dem Ende zuneigt: Ein Besuch dieser Ausstellung lohnt sich.
»Bademode«, bis zum 5. November, Modemuseum Schloss Meyenburg
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.