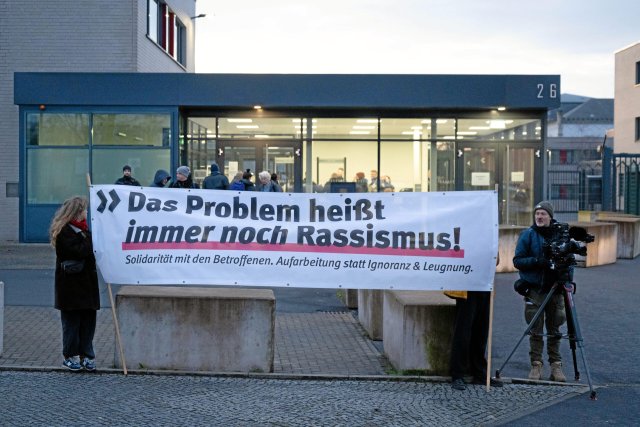- Politik
- Frankreich
»Konsumenten als Kriminelle zu behandeln, ist kontraproduktiv«
Der Kriminologe Alain Bauer über den Umgang mit Drogen in Frankreich

Herr Bauer, welchen Platz nimmt der Drogenhandel in der Kriminalität in Frankreich ein?
Dieser »Handel« unterteilt sich in mehrere spezifische Bereiche, die oft verwechselt werden: Produktion, Verteilung, Verbrauch. Und je nach Art des Betäubungsmittels sind die Auswirkungen auf die Kriminalität unterschiedlich. Frankreich importiert vor allem, produziert aber auch selbst Cannabis und synthetische Drogen. Das Land leidet unter der starken Verbreitung von Kokain und neuartigen Produkten und muss sich auf den zu erwartenden gewaltigen Anstieg von synthetischen Drogen wie Fentanyl, Captagon und Nitazene einstellen.
Aufgrund einer großen Krise in der organisierten Kriminalität in Frankreich um die Aufteilung der Territorien und Märkte für den Drogenhandel sowie der Verlockung, Profit aus dem Menschenhandel zu ziehen, haben sich die Zyklen der blutig ausgetragenen Auseinandersetzungen seit 2006 enorm verschärft.
Frankreich gilt als führendes Land in Europa, was den Handel und Konsum von Drogen angeht? Wie ist es dazu gekommen?
Ob diese weit verbreitete Einschätzung stimmt, lässt sich schwer belegen, denn die Methoden, das zu messen und zu gewichten, sind sehr unterschiedlich. Fest steht, dass Frankreich eine Drehscheibe für den Drogenhandel in Europa ist und viele Lieferungen das Land im Transit durchqueren. Außerdem ist es allein schon mit seinen fünf Millionen Konsumenten ein bedeutender Markt. Da es an einer alle Aspekte umfassenden und auf die verschiedenen Akteure abzielenden Politik fehlte, setzte sich einzig eine sehr repressive Politik durch, die gegenüber dem Konsum weitgehend unwirksam blieb. Die Konsumenten als Kriminelle zu behandeln, hat sich immer als kontraproduktiv erwiesen, denn die Drogenabhängigkeit erfordert medizinische und psychiatrische Behandlung, während man gegen den Drogenhandel mit massiven Sanktionen vorgehen muss.
Nach zahlreichen vergeblichen Ansätzen in den vergangenen Jahren will die Regierung jetzt Anlauf für einen umfassenden und effizienten Kampf nehmen. Wird das diesmal mehr Erfolg haben?
Die geplanten Maßnahmen entsprechen weitgehend den Empfehlungen, die eine Untersuchungskommission des Senats als Ergebnis seiner Ermittlungen über die Drogenkriminalität in Frankreich zusammengetragen hat. Doch was dabei immer noch fehlt, ist die Dimension der Behandlung der Drogenabhängigkeit. Aber ohne Konsumenten gäbe es auch keinen Drogenhandel mehr. Die strafrechtliche Dimension des Problems kommt erst nach der medizinischen und psychiatrischen.
Die Regierung lehnt die Legalisierung von Cannabis ab, wie sie bereits in anderen europäischen Ländern existiert. Wie sehen Sie die dort gemachten Erfahrungen und welche Konsequenzen hätte es, wenn auch Frankreich diesen Weg ginge?
Überall wird die Politik der Liberalisierung und Legalisierung bereits wieder kritisch überdacht, weil dieser eingeschlagene Weg schwerwiegende medizinische und psychische Konsequenzen hat. Die reglementierte Verteilung von Drogen verhindert nicht, dass auch dies durch kriminelle Gruppen beherrscht wird. Das können wir in den Niederlanden beobachten. Das Angebot illegaler Produkte steigt schnell und damit auch die Zahl der Konsumenten unter den jungen Menschen oder den Jugendlichen.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.