- Politik
- Entwicklung von Kap Verde
Wenn die Hoffnung mehr und mehr versiegt
Vor 50 Jahren feierte Kap Verde seine Unabhängigkeit. Seitdem ist viel erreicht worden, aber viele Menschen wandern trotzdem aus

5. Juli 1975. Im Fußballstadion der Hauptstadt Praia haben sich Hunderte Menschen versammelt. Über ihren Köpfen fliegen Segelflieger, singende Zivilist*innen marschieren ein, um den Moment zu feiern, für den sie alle hier sind: die Verkündung der Unabhängigkeit Kap Verdes.
Julio Monteiro ist zu dem Zeitpunkt ein 24-jähriger Soldat ohne Einheit in den Revolutionären Streitkräften des Volkes, dem bewaffneten Flügel der Unabhängigkeitsbewegung. An diesem Tag hatte er eigentlich den Auftrag, die Flagge der Streitkräfte zu tragen.
Doch es sollte anders kommen: »Um fünf Uhr nachmittags rief mich mein Chef zu sich«, erinnert sich der Veteran. »Er trug mir auf, stattdessen die neue Flagge der Republik zu holen, die der Präsident in der Zeremonie übergeben sollte.« So geriet der junge Mann unvermittelt in den Mittelpunkt der Staatsgründung. »Das war nicht geplant«, erzählt er. »Ich war komplett überfordert, weil ich keine Ahnung hatte, was genau ich zu tun hatte.« Gemeinsam mit zwei Kameraden sollte er nach der Unabhängigkeitsverkündung die Flagge hissen. Eine Symbolik, die das Ende von fünf Jahrhunderten portugiesischer Kolonialverwaltung auf der Inselgruppe rund 600 Kilometer westlich der Küste Senegals einläutete.
Bis heute hat sich jedes Detail der Szene in Julio Monteiros Erinnerung eingebrannt. Die Gänsehaut, die sich über seinen ganzen Körper ausbreitet, als er nach der Rede zum Mikrofon gerufen wird. Wie seine Hände in den weißen Handschuhen zu zittern beginnen, als er die Flagge aus der Hand des Präsidenten Aristides Pereira nimmt und auf die Fahnenstange zuläuft. »Eigentlich bin ich kein unruhiger Mensch«, sagt er. »Aber ich hätte niemals damit gerechnet, als einfacher Soldat ohne Rang im Mittelpunkt dieses historischen Moments zu stehen.«

Monteiros eigene Geschichte beginnt als eines von sechs Kindern in Plateau, dem heute historischen Viertel von Praia. Als er acht Jahre alt war, stirbt sein Vater, und die Mutter bringt die Familie fortan allein durch. Von ihr habe er den Kampfgeist geerbt, sagt Monteiro. Nicht nur durch ihr Vorbild als Mutter, sondern auch durch das als eine der wenigen Volksvertreterinnen innerhalb des kolonialen Verwaltungssystems.
Er besucht eine der beiden einzigen Sekundarschulen im Land und arbeitet anschließend im Öffentlichen Dienst. Das Ausmaß an Armut, das ihm dabei begegnet, bewegt ihn schließlich dazu, der Unabhängigkeitsbewegung beizutreten. Diese wurde damals von der Partei PAIGC getragen, der Afrikanischen Partei für die Unabhängigkeit Guineas und Kap Verdes, einer linksnationalen Bewegung, angeführt vom kapverdischen Intellektuellen Amilcar Cabral. In den 60er und frühen 70er Jahren führte sie in Guinea-Bissau den Guerillakampf gegen Portugal bis zur Unabhängigkeit Guinea-Bissaus 1973.
Als Kap Verde zwei Jahre danach selbst seine Unabhängigkeit verkündet, sieht sich die neue Republik mit einer Fülle an Herausforderungen konfrontiert: Der von Dürren und Hungersnöten geplagte Archipel verfügt kaum über nennenswerte natürliche Ressourcen und ist in vielen Bereichen auf Importe angewiesen. Dabei ist das Industrialisierungsniveau niedrig und die Armut hoch. Für viele internationale Beobachter*innen galt der kleine Inselstaat als hoffnungsloser Fall.
Ein halbes Jahrhundert später hat sich das Land grundlegend gewandelt. Inzwischen leben auf der Inselgruppe rund 600 000 Menschen. Aus den zwei weiterführenden Schulen ist ein Schulsystem gewachsen, das mittlerweile mehr als 90 Prozent der Bevölkerung das Lesen und Schreiben gelehrt hat. Die Lebenserwartung liegt bei 76 Jahren, und laut Weltbank war die Drei-Dollar-Armutsrate 2021 auf 14,6 Prozent gefallen. 20 Jahre zuvor hatte sie noch 37 Prozent betragen. Im Vergleich mit anderen afrikanischen Staaten besticht Kap Verde durch seine gefestigten demokratischen Strukturen und einen niedrigen Wert im Korruptionsindex.
Wie konnte in so kurzer Zeit all das erreicht werden? Für Professor Odair Barros Varela von der Universidade de Cabo Verde liegt das an verschiedenen Startvorteilen Kap Verdes gegenüber vielen seiner Nachbarländer. Das beginne mit der langen demokratischen Tradition, die bereits mit Formen der Selbstverwaltung innerhalb des Kolonialapparats begonnen habe und sich im unabhängigen Staat in einer strikten Abgrenzung politischer Akteure zum Militär fortgesetzt habe. Im Gegensatz dazu putschte in Guinea-Bissau das Militär seit der Unabhängigkeit häufiger. »Das sind Grundsteine der Stabilität, die wir noch heute haben«, sagt der Politikwissenschaftler.
Sicherlich trägt auch das Inseldasein dazu bei, dass Auseinandersetzungen in benachbarten Ländern nicht so leicht auf Kap Verde übergreifen. Zudem hat die größtenteils kreolische Bevölkerung keine ethnischen Konflikte auszutragen. Anders als etwa multiethnische Staaten, in denen die ehemaligen Kolonialisten einst ohne Rücksicht auf die Bevölkerung die Grenzen zogen.
Diese Merkmale erlaubten es der politischen Elite, über die Jahre mit den internationalen Mitteln und Überweisungen der Emigrierten das Land zu entwickeln, erläutert Varela. Auch wenn inzwischen mindestens 700 000 Kapverdianer*innen im Ausland leben und ihre Zuwendungen rund ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts ausmachen.
Die politische Stabilität und ein scheinbar geräuschloses Regieren haben Kap Verde dennoch zu einem Land gemacht, in denen Geberländer vorzugsweise investierten. Zeitweise empfing der Staat weltweit mit die größte Menge an Entwicklungshilfe pro Kopf, bis er schließlich 2008 offiziell die Einstufung als Entwicklungsland hinter sich ließ. »Die internationale Gemeinschaft führt Kap Verde gerne als Modell vor, weil sie schlicht keine anderen gelungenen Beispiele vorweisen kann«, erklärt Varela.
Dabei hat der Archipel noch immer nicht die besten wirtschaftlichen Voraussetzungen. Das trockene Sahelklima lässt nur eingeschränkt Landwirtschaft zu; der Fischreichtum ist begrenzt, es gibt wenig Industrie, dafür entwickelt sich der Tourismus, etwa 25 Prozent trägt er zum Bruttosozialprodukt bei.
»Armut gibt es immer noch. Auch wenn die Politiker*innen so reden, als wären alle Probleme gelöst.«
Julio Monteiro
Julio Monteiro ist heute Rentner. Fast sein gesamtes berufliches Leben hat er beim Militär verbracht. »Die Welt hat sich seit damals verändert.« Er sehe zwar eine Entwicklung, aber nicht, dass diese gleichermaßen bei der gesamten Bevölkerung ankomme. »Armut gibt es immer noch. Auch wenn die Politiker*innen so reden, als wären alle Probleme gelöst.« Die Bevölkerung werde heutzutage vor allem als Wahlvolk angesehen, meint er.
Gerade erst Ende Juni verkündete Premierminister Ulisses Correia e Silva die Pläne der Weltbank, Kap Verde ab nächstem Jahr wirtschaftlich eine Kategorie weiter heraufzustufen, als Land mit oberem mittleren Einkommen.
Während der Wohlstand allgemein wächst, steigt allerdings auch die Ungleichheit. Für Monteiro ist die Sache klar: »Vom Neoliberalismus, dem sich das Land heute verschrieben hat, profitieren vor allem ein paar wenige und ausländische Investor*innen«, sagt er. »Besonders die politischen Kräfte, die sich links nennen, sollten stattdessen besser danach streben, das Land sozialer zu machen, für alle Menschen.«
Das Fußballstadion Várzea, in dem einst die Unabhängigkeit gefeiert wurde, steht scheinbar unverändert im Zentrum von Praia. Die Mauern zieren Wandmalereien von Peace-Zeichen und Friedenstauben, daneben befindet sich eine Fernbusstation mit Minivans. Hier befindet sich der Obststand von Lucinda. Die Verkäuferin mit der typischen Marktfrauenschürze ist dieses Jahr selbst 50 Jahre alt geworden. Als Kind der Unabhängigkeit hat sie die Kolonialzeit nicht mehr erlebt. »Meine Eltern haben mir vor allem von Hunger und Dürren erzählt«, erinnert sie sich. »Davon, dass es nichts zu essen gab und die Menschen deshalb den Kampf aufgenommen haben.«
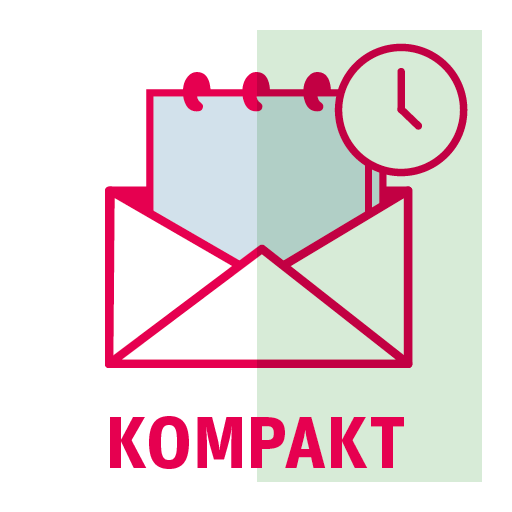
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Einer ihrer Onkel sei damals während der Hungersnot 1947 gestorben, erzählt sie. Auch in ihrer Kindheit seien Nahrungsmittel knapp gewesen. Was ihre Eltern außerhalb der Stadt anbauen konnten, hätten sie in Praia verkauft. Manchmal habe ihr Vater von den Nachbarn stehlen müssen, um seine Kinder zu ernähren. »Im Grunde hat sich für uns nicht viel verändert«, sagt sie sichtlich resigniert. Auch sie verkaufe Obst, und das Geld reiche vorne und hinten nicht. Ihre vier Kinder haben alle die Schule besucht. Zwei haben danach nur als Hausangestellte Arbeit gefunden. Die anderen beiden mit Ausbildung finden keinen Job.
Noch immer suchen viele junge Kapverdier*innen daher anderswo nach Perspektiven. »Leider dient es sogar den Interessen der politischen Eliten, wenn die Jugend abwandert«, meint Odair Varela. Der Universitätsprofessor hat in den vergangenen Jahren selbst erlebt, wie sich die Zahl seiner Studierenden halbiert hat. Viele junge Köpfe seien ausgewandert und somit aus dem politischen Wettbewerb ausgeschieden, berichtet er.
Fragt man Julio Monteiro nach seinem Blick in die Zukunft, schmunzelt der 74-jährige. »Ich bin ja schon alt«, sagt er. »Am Ende werden wir sehen, wohin sich das Land entwickelt. 50 Jahre sind vielleicht viel für ein Menschenleben, aber nicht für ein Land.« Die Straße, in der Monteiro aufgewachsen ist, ist heute nach dem Unabhängigkeitsführer Cabral benannt, der im Januar 1973 bei einem Attentat ums Leben kam. Dessen Gedenken sieht Monteiro mit jeder Generation weiter verblassen.
Dem Rentner jedoch bleiben die Erinnerungen – wie jene an diesen Samstagnachmittag 1975 auf dem Fußballfeld. Während die Hymne schon gespielt wird, unterläuft den drei Soldaten ein Fehler mit den Seilen. Die Flagge lässt sich nicht hissen. »Es kam mir vor wie eine Ewigkeit.« Dann, plötzlich, habe sich die Sonne verdunkelt und ein Wind sei aufgezogen. Die Flagge wehte. »Alle sagten im Nachhinein, da sei etwas Seltsames passiert«, gesteht er und fügt hinzu, »manche Leute meinten, es sei der Geist Amilcar Cabrals gewesen, der dort vorbeigezogen ist.«
Diesen Geist gelte es wiederzubeleben. Denn »frei nach Cabral« sagt Monteiro: »Die Unabhängigkeit erkämpft man nicht, um eine Flagge auszuwechseln, sondern um ein Land so zu verändern, dass die Menschen dort besser leben.«
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.






