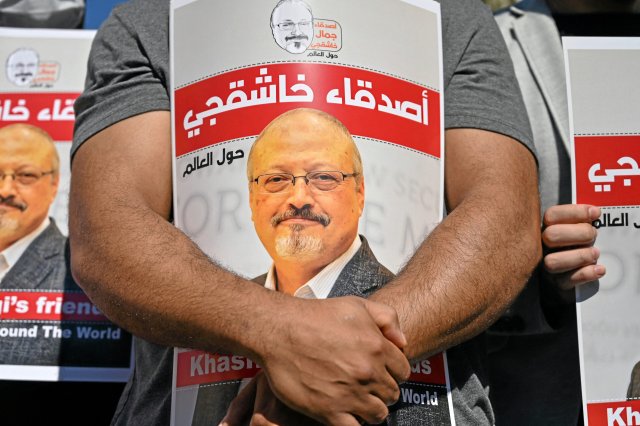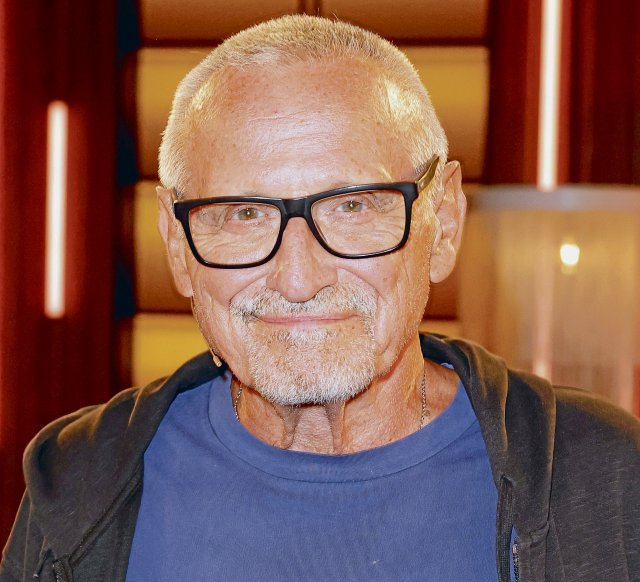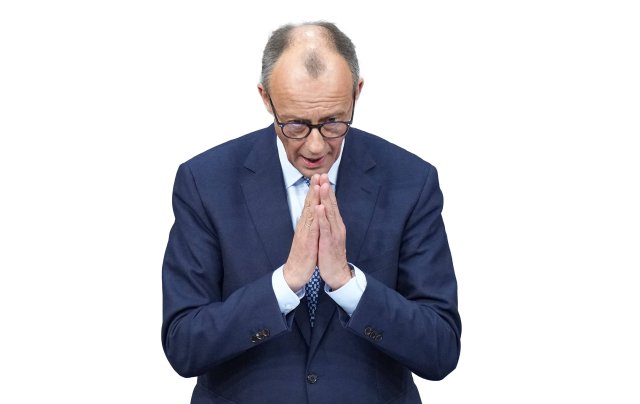- Kommentare
- Fast Fashion
Wegwerf-Mode: Weniger ist sehr viel mehr
Kurt Stenger über die gigantischen Kleidermüllberge

Es ist ein gigantischer Markt: 1 676 257 457 732,79 US-Dollar beträgt der Umsatz der weltweiten Bekleidungsbranche in diesem Jahr. Also fast 1,7 Billionen Dollar. Gleichzeitig entsteht Jahr für Jahr ein gigantischer, wachsender Abfallberg, worauf die Boston Consulting Croup in einer Studie hinweist. Mit Blick auf die darin steckenden dreistelligen Milliardensummen an Materialwert hält die Unternehmensberatung dies natürlich für eine Verschwendung und fordert den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche. Dies erinnert nicht zufällig an die Debatten, die derzeit bei den Verhandlungen über ein UN-Plastikabkommen geführt werden. In Bekleidung stecken häufig alle möglichen Kunstfasern, die Mikroplastik freisetzen und die Wiederverwertung erschweren.
Das Ganze ist Ergebnis von Fast Fashion – die Industrie setzt auf ständig wechselnde Modetrends und Konsumdruck, was eine Billigproduktion mit miserablen Arbeitsbedingungen, riesigen Umweltproblemen und unnötig hohen CO2-Emissionen nach sich zieht. Dass Vintage zunehmend Anhänger findet, ist natürlich zu begrüßen. Doch um das gigantische Abfallproblem zu lösen, braucht es auch strenge Vorgaben für die Produktion: und zwar nicht nur mit Blick auf Recycelbarkeit, die letztlich begrenzt ist.
Die schiere Menge ist das zentrale Problem, womit es ans Eingemachte geht: Eine auf schnelles Wachstum ausgerichtete Wirtschaftsweise, in der umweltzerstörerische Fast Fashion mit riesigen Abfallbergen rentabler ist als nachhaltige Produktion, hat ausgedient. In vielen Bereichen, aber in der Bekleidungsindustrie in besonderem Maße, wird klar erkennbar, was dem Kapitalismus fremd ist: Weniger ist letztlich sehr viel mehr.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.