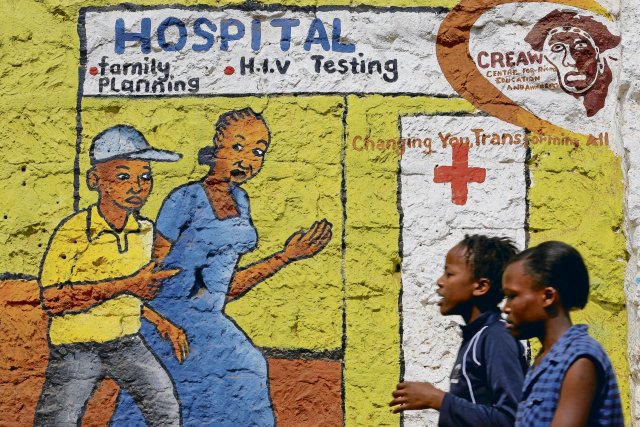- Wirtschaft und Umwelt
- Jackson Hole
Notenbankertreffen: Das exklusivste Wirtschaftstreffen der Welt
Im US-amerikanischen Jackson Hole treffen sich führende Zentralbankchefs hinter verschlossenen Türen

»Wir sind die Letzten des alten Westens«, wirbt die Gemeinde Jackson Hole um amerikanische Touristen. Ab Donnerstag folgen Zentralbanker aus aller Welt diesem Ruf in den US-Bundesstaat Wyoming. Seit 1981 organisiert die Federal Reserve Bank of Kansas dort eine Fachtagung zur Wirtschaftspolitik, das »Jackson Hole Economic Symposium«.
Neben dem Präsidenten der amerikanischen Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, werden gut hundert Banker, Wirtschaftswissenschaftler, Vertreter der US-Regierung und ausgewählter Medien anwesend sein. Sie reden miteinander über wirtschaftspolitische Themen von grundlegender Bedeutung für die Arbeit der Zentralbanken. Hinter verschlossenen Türen.
Das exklusivste Wirtschaftstreffen der Welt, wie die »New York Times« Jackson Hole einmal nannte, wird von den Finanzmarktakteuren weltweit dennoch genauestens beobachtet. Sie ziehen daraus Rückschlüsse auf die künftige Geldpolitik der Fed und EZB in Frankfurt sowie auf die internationale Zinsentwicklung in diesem Jahr.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Zentralbanken verfolgen ein grundlegendes Ziel, die Stabilität des Geldes zu gewährleisten. Das heißt: Die Preise sollen nicht zu schnell steigen und keinesfalls sinken. Als konkretes Ziel galten daher lange Zeit zwei Prozent Inflation im Jahr. Bei diesem Wert würde sich die Volkswirtschaft am besten entwickeln. Nun können Ökonomen über die Sinnhaftigkeit des Zwei-Prozent-Ziels trefflich streiten. Als Crux für die Zentralbankvorstände erwies sich jedoch hauptsächlich, dass in den meisten Jahren das selbst gesteckte Ziel verfehlt wurde.
Vor diesem Hintergrund hatte sich in Jackson Hole ein Strategiewechsel angebahnt. Statt eines starren Ziels schlug Fed-Chef Powell im Sommer 2020 einen »Zielkorridor« für die Inflationsrate vor, möglicherweise verbunden mit einer Anhebung der durchschnittlichen, von der Fed angestrebten Preissteigerungsrate. Künftig sollte in den Vereinigten Staaten »die Preissteigerung für eine Weile höher als zwei Prozent liegen [dürfen], wenn sie sich zuvor für einen längeren Zeitraum darunter bewegt hat«. Die Euro-Notenbank EZB war schon vor Christine Lagardes Amtsantritt 2019 zu ähnlichen Schlüssen wie Powell gelangt.
»Mittelfristig« will die EZB nun ein Inflationsziel von zwei Prozent erreichen und »kurzfristige« Abweichungen hinnehmen. Damit verschaffte sich die EZB ebenfalls einen Zielkorridor, der intern schätzungsweise zwischen ein und vier Prozent Inflation liegt. Dieser Korridor erlaubt der Geldpolitik – deren Instrumentenkasten seit der Finanzkrise an Größe und Wirksamkeit gewonnen hat – einen weit größeren Spielraum.
Denn sie muss nun nicht mehr bei überschäumender Konjunktur sofort mit Zinserhöhungen reagieren. Und sie kann nach einer längeren Schwächephase und anziehender Inflation die Leitzinsen niedrig halten, um das Wirtschaftswachstum abzusichern. Letzteres könnte im kommenden Jahr an Gewicht gewinnen, sollte die Konjunktur in Deutschland und der Eurozone nach schwachen Zeiten wieder richtig Fahrt aufnehmen.
Mit diesem noch recht jungen Zielkorridor im Rücken weigert sich der 72-jährige Powell bislang, die vergleichsweise hohen Leitzinsen zu senken. Was ihn auf die politische Abschussliste von US-Präsident Donald Trump gebracht hat, der sich von sinkenden Zinssätzen einen kräftigen Antrieb für Konjunktur und Börsenkurse verspricht. Mehrfach hat Trump in den vergangenen Monaten Powell heftig, auch persönlich, attackiert. 2017 hatte Trump selber den früheren Investmentbanker zum Vorsitzenden der Fed ernannt. Powells Amtszeit endet im kommenden Mai.
Powell setzt in Jackson Hole jetzt ein ganz anderes Ausrufungszeichen. Das diesjährige Leitthema lautet »Arbeitsmärkte im Wandel: Demografie, Produktivität und makroökonomische Politik«. Die meisten Länder im Globalen Norden beklagen nicht nur ein seit Jahrzehnten abflauendes Wirtschaftswachstum, sondern zudem ein geringeres Potenzialwachstum. Das ist das langfristig mögliche Wachstum bei normaler Auslastung der Unternehmen. Denn die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf Arbeitswelt, Konjunktur, auf Sozialsysteme – und auf die Geldpolitik der Zentralbanken.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.