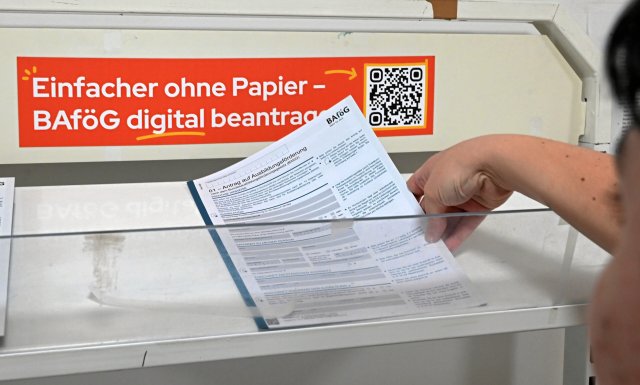- Politik
- Klimabewegung
Etwas Besseres als den Untergang
Statt sich in Katastrophenstimmung zur Preppergemeinschaft zusammenzurotten, muss eine linke Klimabewegung die Produktion übernehmen

In der Debatte um den Klimawandel hat die Idee, dass wir uns solidarisch auf die nunmehr unaufhaltsame Katastrophe vorbereiten müssen, einen Nerv getroffen. Tadzio Müller hat mit seinem Buch »Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps« die Idee formuliert, dass der Zusammenbruch unausweichlich sei und dass die Klimabewegung zu einer »solidarischen Kollapsbewegung« werden müsse. Ende August wird sogar ein »Kollapscamp« zu dem Thema stattfinden, auf dem es, so die Webseite, darum gehen wird, wie wir »handlungsfähig« bleiben können: »in der Katastrophe, im Kampf gegen Polizei und Nazis und auf lange Sicht.«
Prepping ist nicht Kommunismus
Hintergrund für diese Ideen ist erstens die Einschätzung, dass der Staat uns nicht retten wird. Er wird weder die Klimakatastrophe eindämmen noch uns vor deren Folgen schützen. Es ist gut, dass der Glaube an den Staat in Teilen der Klimabewegung verloren gegangen ist, nachdem noch vor wenigen Jahren die zentrale Botschaft auf großen Demonstrationen von Fridays for Future (etwa im September 2021) war, die Grünen zu wählen. Die zweite Einschätzung, dass die Klimakatastrophe unabwendbar sei, ist jedoch problematischer. Denn auch wenn Kipppunkte überschritten sind und der Klimawandel bereits jetzt katastrophale Folgen zeitigt, macht es dennoch einen Unterschied ums Ganze, wie die Gesellschaft damit umgeht und ob linke Kräfte zum Beispiel dafür kämpfen, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren oder nicht. Wenn man annimmt, dass die Linke im Großen und Ganzen nichts ändern kann und dass sie ihre Marginalität akzeptieren muss, fällt diese Option aus.
Obwohl sie also marginal und politisch unbedeutend ist, soll diese Linke – und hier wird es wirklich problematisch – es trotzdem schaffen können, sich solidarisch auf die Katastrophe vorzubereiten. Wenn solidarisch aber bedeutet, dass alle versorgt werden, auch Arme und Kranke sowie Menschen, die keine Kontakte zur »solidarischen« Prepperszene haben, dann ist das kaum möglich aus einer Position gesellschaftlicher Marginalität heraus. Preppen kann aus einer solchen Position heraus nicht solidarisch sein.
Abgesehen davon, dass Preppen aus einer solchen Position heraus nicht solidarisch sein kann, funktioniert auch herkömmliches, unsolidarisches Preppen nicht: selbst eine Kommune von jungen, gesunden, wohlgenährten Menschen im Wendland mit allerlei Survival-Technik und Solarzellen auf dem Dach ist ohne globale Lieferketten dem Untergang geweiht, wenn es zum Kollaps kommt. Wasser, Medikamente, medizinische Geräte, Energieversorgung und Essen gibt es nicht ohne globale Kooperation. Selbst wenn sie als bessergestellte Prepper*innen ein paar Wochen überlebten, drei Millionen verhungernde Berliner*innen würden ihnen wahrscheinlich das Leben zur Zombie-Hölle machen und die Solidarität würde vermutlich schnell unter die Räder kommen. »Solidarisch Preppen« geht nur, wenn alle mitgedacht werden. Und dann ist es kein Preppen mehr, sondern Kommunismus.
Selbstverständlich ist nichts dagegen einzuwenden, sich gegenseitig nützliche Fertigkeiten beizubringen, und es stimmt, dass der Staat Menschen immer mehr im Stich lässt, zum Beispiel in der Pflege, und dass es daher die praktische Notwendigkeit gibt, sich entsprechend selber zu organisieren. Doch die Möglichkeiten dazu sind de facto durch unsere Abhängigkeit von globalen Lieferketten begrenzt, egal ob es um Pflege oder um Landwirtschaft geht. Anstatt also der Illusion anzuhängen, wir könnten uns im Kleinen auf die Katastrophe vorbereiten und uns irgendwie lokal oder regional absichern, sollten wir uns die materiellen Abhängigkeiten des gesellschaftlichen Zusammenhangs klarmachen und daraus unsere Schlüsse ziehen: Was müsste passieren, damit alle versorgt sind? Sich das nicht einmal mehr vorzustellen und nur noch ein Stückchen vom Kuchen zu wollen, statt die ganze Bäckerei zu übernehmen, bedeutet, den Herrschenden das Feld kampflos zu überlassen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die ganze Bäckerei
Wie übernimmt man also die ganze Bäckerei? Lars Hirsekorn, Gewerkschafter und VW-Betriebsrat aus Braunschweig, hat kürzlich in einem Interview ein Beispiel dafür gegeben, was ein erster Schritt sein könnte. In einem nahe gelegenen Krankenhaus wurde gestreikt, aber es war nicht möglich, eine Streikdelegation aus dem Krankenhaus zur Betriebsversammlung bei VW einzuladen. Dass die Autoarbeiter*innen den Streik unterstützen, der in ihrem ureigenen Interesse ist, wäre aber ein wichtiger erster Schritt: Wenn sie krank sind oder alt werden, müssen sie in dieses Krankenhaus, weil es in ihrem Einzugsgebiet liegt, und je nachdem, wie gut sich die Kolleg*innen dort durchsetzen, wird die Versorgung besser oder schlechter ausfallen. Und je tatkräftiger sie die Kolleg*innen unterstützen, desto erfolgreicher wird deren Streik.
Doch das müsste bei VW im Betrieb organisiert werden, aktive Kolleg*innen müssten sich um die Durchsetzung kümmern. Von diesen gibt es aber derzeit noch zu wenige, dabei wäre genau hier ein Punkt, an dem die gesellschaftliche Linke einhaken könnte. Lars Hirsekorn kritisiert auch öffentlich seine Gewerkschaft und fordert, dass die IG Metall sich gegen den Verkauf von VW Osnabrück an Rheinmetall und als emanzipatorische politische Kraft klar gegen den allgemeinen Militarisierungswahn stellt. Auch hier fehlt es an weiteren Kolleg*innen, die dafür Druck machen.
Ein anderes Beispiel: In Berlin haben Angestellte aus dem Gesundheitswesen einen Solidaritäts-Fonds für den Streik der Beschäftigten der Charité-Servicetochter CFM ins Leben gerufen. Die Kolleg*innen verdienen so wenig, dass das Streikgeld nicht ausreichte. Durch den Solifonds konnte den Kolleg*innen die Teilnahme am Streik ermöglicht werden. Gleichzeitig wurde ihnen vermittelt, dass sie nicht alleine sind im Kampf gegen die politischen Bedingungen der Dumpinglöhne. Alle Streiks brauchen solche oder ähnliche Unterstützung von außen, vor allem, wenn die Beschäftigten sich nicht mit Krümeln zufrieden geben wollen. Es ist ein weites Betätigungsfeld.
Wir machen uns als Linke überflüssig und überlassen das Feld den Faschist*innen, wenn wir die Idee aufgeben, normale Leute, die keinen Kontakt zur linken Szene haben, mitzunehmen. Wir müssen da sein, wo die Leute sind und eine gesellschaftliche Atmosphäre erzeugen, in der es klar ist, dass wir uns als Klasse gegen Ausbeutung, Aufrüstung, Sparpakete wehren können, praktisch, in den Kämpfen und auf Arbeit. In einer solchen Atmosphäre können wir anfangen, die nötigen Gespräche zu führen: darüber, wie wir gemeinsam als Belegschaften Verantwortung für die Produktion übernehmen und die Herrschaft des Kapitals abschütteln können. Wir müssen dieses Ziel vor Augen haben – sonst ist die Alternative, sich in der Barbarei einzurichten. Ich glaube, es gibt kein Drittes.
Für ein Filmprojekt, an dem ich mitwirkte, haben wir kürzlich einen Kollegen, der Umspannwerke installiert, drei Landarbeiter*innen, einen Maschinenbau-Facharbeiter, eine Postangestellte, zwei Autoarbeiter*innen und einen Kollegen, der für eine Wasseraufbereitungsfirma arbeitet, gefragt, wie man ihre Arbeit auf eine vernünftige und nachhaltige Art und Weise organisieren könnte. Die Kolleg*innen hatten einfache, klare Antworten parat, sie schienen alle zuversichtlich, dass das in der Sache möglich sei. Das Problem sei aber, dass die meisten ihrer Kolleg*innen keine politische Alternative sehen, nicht an die Möglichkeit glaubten, sich zusammenzuschließen und den Chefs die Produktion aus der Hand zu nehmen. Was fehlt, sind also Genoss*innen in den Betrieben, die zuversichtlicher sind, im Betrieb Gespräche führen über die Themen, die gerade obenauf liegen, Debatten politisch zuspitzen, Kontakt zu anderen Belegschaften herstellen und so die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Belegschaften in der Zukunft Teil einer neu erblühenden Klima- und Antikriegsbewegung werden und ihnen Gewicht verleihen.
In einer solchen Dynamik könnten dann die Umrisse einer post-kapitalistischen Gesellschaft für alle sichtbar hervortreten. Immerhin: Niemand glaubt mehr, dass wir eine Zukunft im bestehenden System haben und Debatten um eine ökologische, demokratische Planwirtschaft haben schon länger wieder Konjunktur. Wir haben nur begrenzte Kräfte. Deshalb müssen wir sie im Sinne einer Strategie einsetzen, die die ganze Gesellschaft und die Produktionsweise insgesamt in den Blick nimmt. Alles andere ist Quark.
Johanna Schellhagen ist Filmemacherin und arbeitet für Labournet TV.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.