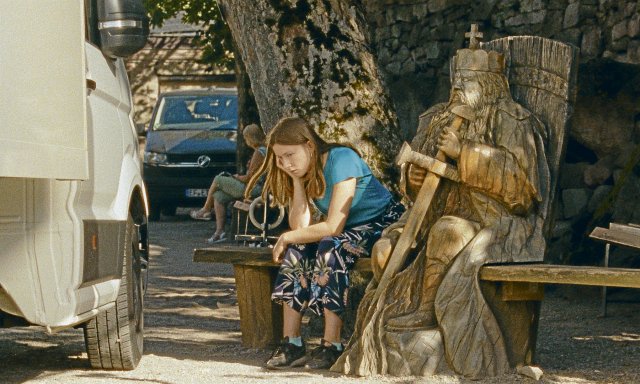- Kultur
- Ukraine-Krieg
Die Zukunft beginnt nicht mit Ultimaten
Ideologische Parolen nutzen niemanden, nüchterne Friedenspolitik ist gefragt

Die Ukraine ist kein homogener Staat – sie ist ein geopolitischer Resonanzraum. Seit Jahrzehnten wird ihr Schicksal nicht nur von innen, sondern zunehmend von außen geprägt. Zwischen westlichen und östlichen Interessen aufgerieben, ist sie Sinnbild und Mahnung zugleich: für das Scheitern von Verständigung, für das Verdrängen historischer Erfahrungen und für eine politische Praxis, die Frieden zunehmend militärischer Logik unterordnet. Es ist an der Zeit, die Frage neu zu stellen: Wie können wir als Gesellschaft – als Wissenschaft, als Politik, als europäische Öffentlichkeit – der Jugend in Europa eine Zukunft geben, die nicht vom Krieg bestimmt wird? Was bedeutet es heute, eine gesamteuropäische Friedensordnung zu denken – eine Ordnung, die Russland nicht ausgrenzt, sondern einbindet?
Diese Fragen hatten für mich einen biografischen, eher zufälligen Ursprung. Eine weltkriegsbedingte Grabsuche zum Vater eines Freundes führte mich dorthin. Daran anschließend habe ich seit 2005 die Ukraine durch zahlreiche Lehraufträge an Universitäten in Odessa, Lviv und Charkiv kennengelernt. Dort, im Austausch mit jungen Juristinnen und Juristen, wuchs die Erkenntnis, dass fundamentale Rechtspolitik mehr schaffen muss als einen Gesetzes-Staat. Einen eigenen Weg in Unabhängigkeit und Kooperation nach allen Seiten zu beschreiten, war ein vorherrschendes Leitbild für einen zu entwickelnden Rechts-Staat, der jeder Politik unüberschreitbare Grenzen der Macht aufzeigen muss. Eine Publikation unter dem Titel »Der eigene Weg der Ukraine« entstand im gemeinsamen Diskurs dreier ukrainischer Universitäten (Odessa, Lviv, Charkiw) und der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ein solches freiheitliches Bemühen wurde im Spannungsfeld geopolitischer Machtinteressen zusehends deformiert und wird heute in einem geopolitischen, kriegerischen Zugriff vollkommen untergepflügt.
Die politische Ohnmacht der Ukraine wurzelte von jeher in einer strukturellen Überforderung: ein riesiges Land, doppelt so groß wie Deutschland, mit über 40 Millionen Menschen. Die Ukraine ist seit Langem von einem inneren Spannungsverhältnis geprägt – zwischen einem westlich orientierten, europanahen Landesteil im Westen und einem russlandnahen, kulturell und sprachlich anders geprägten Osten. Ein territorialer Interessenausgleich und eine ökonomische Stabilisierung durch eine Vertragslösung wären gemäß der drei Friedens-Chartas der OSZE für beide Konfliktparteien, selbst noch kurz vor dem völkerrechtswidrigen russischen Einmarsch, möglich gewesen. Das vermittelte explizit am 14. Februar 2022 in der »Neuen Zürcher Zeitung« Thomas Greminger, der bis 2020 tätige Generalsekretär und heutige Schweizer Botschafter an der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE). Doch der Westen lehnte das ab. Gefangen zwischen der Einflusszone des Westens und den Sicherheitsinteressen Russlands wurde aus dem Streben nach einem eigenen Weg ein Überlebenskampf im Windschatten der Blocklogik – ein Abstieg, der sich als zivilisatorischer Verfall erweist, weil er nicht nur zu unermesslichen Opfern auf allen Seiten führt, sondern ganze Generationen entmutigt.
Hier beginnt die Verantwortung Europas. Wenn die europäische Integration mehr sein soll als ein wirtschaftliches Projekt, dann muss sie auch ein Friedensprojekt bleiben – im Inneren wie nach außen. Der Frieden, den Europa so gerne beschwört, darf nicht zur exklusiven Ressource werden, von der andere ausgeschlossen bleiben. Eine europäische Friedensordnung ist nur dann glaubwürdig, wenn sie auch Russland einbezieht. Der Versuch, durch Nato-Erweiterung und wirtschaftliche Einflusssphären Russland zu isolieren, hat das Gegenteil bewirkt: Misstrauen, Aufrüstung, Krieg.
Der Weg in eine gemeinsame Zukunft beginnt nicht mit Ultimaten, sondern mit Gesprächen – mit Austausch auf Augenhöhe. Genau das war zentrales Thema in gemeinsamen Seminaren mit Studierenden aus Russland und der Ukraine, die 2017 in Berlin initiiert wurden. Unter dem programmatischen Titel »Lasst der Jugend die Zukunft!« trafen sich 16 Studierende beider Länder, um gemeinsam über föderale Lösungen, soziale Gerechtigkeit und friedlichen Wandel zu diskutieren. Was in diesen Begegnungen spürbar wurde, war ein gemeinsames Bedürfnis: Die Studierenden erörterten in ihren Essays pragmatische Vorschläge zu föderalen und dezentralen Lösungen des Konflikts zwischen beiden Ländern, jeweils getragen von regionaler Autonomie. Frieden also nicht als politisches Manöver, sondern als zivilisatorisches Ideal.
Es war ein Echo auf die Erfahrung Europas nach 1945: Frieden ist nicht Geschenk, sondern mühsam errungener Zustand, der Pflege, Geduld und historischen Tiefensinn verlangt. Gerade dieser Tiefensinn fehlt heute in der politischen Debatte. Historisches Wissen wird ersetzt durch moralische Kurzschlüsse. Wer heute nach Verständigung mit Russland ruft, steht schnell unter Verdacht. Doch wer Geschichte kennt, weiß: Otto von Bismarck war kein Pazifist, aber ein Realist. Nach den sogenannten deutschen Einigungskriegen erkannte er die geostrategische Logik Europas: »Mit Russland niemals Krieg!« war keine ideologische Parole, sondern Ausdruck einer nüchternen Friedenspolitik, die Deutschland zweimal missachtete – und zweimal dramatisch unterging.
Es ist diese Lehre, die heute Geltung beanspruchen muss. In einer Welt atomarer Bedrohung und globaler Erschöpfung kann Krieg kein Mittel der Politik mehr sein. Nur eine Politik des Ausgleichs, der Anerkennung gegenseitiger Sicherheitsinteressen, kann überleben. Das bedeutet nicht, Unrecht zu relativieren. Es bedeutet, in der Suche nach politischer Stabilität nicht auf moralische Selbstgewissheit zu bauen, sondern auf Strukturen des Vertrauens für ein ökonomisches und kulturelles Miteinander – und auf Institutionen, die gemeinsame Interessen sichtbar machen, nicht nationale Narrative zementieren.
Vorabdruck aus dem Prolog von Peter‑Alexis Albrecht, emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Frankfurt am Main, zu dem von ihm mit Herwig Roggemann, emeritierter Professor der Freien Universität Berlin, herausgegebenen Buch »Die Ukraine im zerstörerischen Zugriff globaler Machtpolitik« (Vergangenheitsverlag, 240 S., br., 18 €).
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.