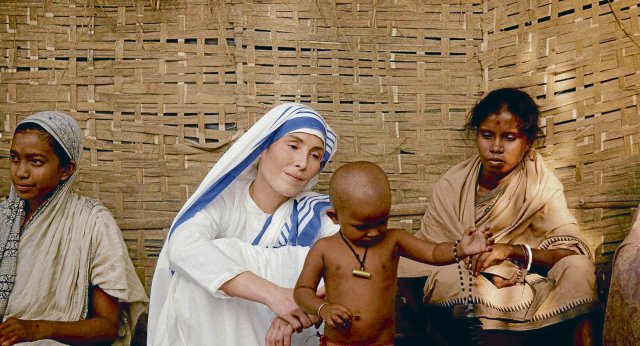- Kultur
- Alternative China
Mit Wundergras, aber ohne Wunder aus der Armut
Ein Gegenentwurf: Uwe Behrens schildert Chinas Weg in die Zukunft

Die Volksrepublik China hat erklärt, 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit zu haben. Hätte Beijing behauptet, alle Uiguren – und davon gibt es etwa zehn Millionen auf chinesischem Staatsgebiet – müssten ab sofort Turban tragen, hätten sich vermutlich Heerscharen von Journalisten aufgemacht, dies vor Ort zu überprüfen. Die Tatsache aber, dass so viele Chinesen, wie Menschen in den USA und in der EU leben, nicht mehr Not leiden müssen, scheint keiner Nachfrage wert.
Doch, mindestens einen hat es interessiert. Der aber ist kein Journalist, sondern ein ehemaliger Logistiker, der 27 Jahre in China gelebt hat und unverändert von der Neugier getrieben wird. Uwe Behrens stellte sich die naheliegenden Fragen: Wie haben sie das gemacht? Und: Ist das wiederholbar? Schließlich wird weltweit gehungert, Kriege und Klimakatastrophen sorgen dafür, dass jeder zehnte Erdenbürger nicht genug zu essen hat. Und es werden immer mehr.
Behrens ist in Beijing mit seiner chinesischen Frau ins Auto gestiegen und einige Tausend Kilometer durchs Land gefahren. Er hat in Dörfern haltgemacht und in Städten gerastet, abgelegene Orte und Naturschutzgebiete, Touristenhotspots und Museen aufgesucht. Vor allem aber: Er hat mit Menschen gesprochen, sich nach ihren Existenzbedingungen erkundigt, gefragt, ob und was sich in ihrem Leben verändert habe. Es sind Zufallsbegegnungen, keine gezielt ausgesuchten Gesprächspartner. Eine soziologische Untersuchung der anderen Art, durchaus repräsentativ auch ohne vorgegebenen Schlüssel und feststehenden Fragenkatalog.
Nebenbei erfährt der Leser, was für fantastische Naturschutzgebiete, exzellente Museen entstanden sind, und welch vorzügliche Infrastruktur, seit in China der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor entdeckt worden ist. Rund um solche Einrichtungen entstanden in zwei Jahrzehnten Arbeitsplätze in riesiger Zahl.
Der Kampf zur Überwindung der Armut vollzog sich nach der alten chinesischen Weisheit: »Wenn du einer Familie helfen willst, dass sie Fisch essen kann, dann zeige ihr zu angeln.« Der chinesische Staat stellte allenfalls die Angel zur Verfügung, unter Umständen auch einen Angellehrer. Behrens dokumentiert die kollektiven Anstrengungen, die auf allen Ebenen unternommen wurden.
Armut – und das macht den Unterschied aus zu den gängigen Armuts- und Hungerbekämpfungsmaßnahmen andernorts – wurde nicht als individuell verursachtes Problem wahrgenommen, sondern als ein gesellschaftliches. Folglich bedurfte es auch gesamtgesellschaftlicher Anstrengungen, um die Not zu überwinden. Das hatte sich die Volksrepublik schon bei ihrer Gründung auf die Fahnen geschrieben, dabei immer wieder erhebliche Rückschläge durch verschiedene Kampagnen (»Großer Sprung«, »Kulturrevolution«) erfahren, doch den entscheidenden Impuls gab es 1978. »Armut ist kein Sozialismus«, erklärte Deng Xiaoping damals. »Sozialismus heißt, die Armut zu beseitigen.«
In den frühen 90ern kam das erste, auf sieben Jahre angelegte Programm zur gezielten Armutsbekämpfung, es folgten mehrere nationale Konferenzen. Man schickte Teams in die Dörfer, eruierte die soziale Lage jeder Familie. Bei uns hätte man bestimmt geschrien, dass dies ein unzulässiges Eindringen in die Privatsphäre darstelle – aber wie will man die konkrete Situation erfahren, wenn man keine Daten hat?
Die schnell wachsende Wirtschaft schuf eine Vielzahl neuer industrieller Arbeitsplätze in den Städten. Das wiederum führte zu einem Einkommensgefälle zwischen der ländlichen und der städtischen Bevölkerung. Insbesondere die Menschen in entlegenen Regionen mit schwierigen geologischen Bedingungen wie etwa in Guizhou, Xinjiang oder Tibet wurden abgehängt, partizipierten nicht am wirtschaftlichen Aufschwung. Es kamen die Probleme der Wanderarbeiter auf, der Landflucht und deren Konsequenzen.
Dennoch gelang es durch eine Vielzahl von Maßnahmen, erfolgreich gegenzusteuern – beginnend bei der Züchtung ertragreicherer Reissorten über Bildung und Qualifizierung bis hin zur vollständigen Digitalisierung, damit auch der letzte Bergbauer seine Erzeugnisse über das Internet vertreiben kann. In 128 000 der als arm ausgewiesenen Dörfern und in 832 Landkreisen wurde so Armut überwunden. Der von der Uno definierte Grenzwert liegt bei 2,15 Dollar pro Person pro Tag. Alle Einwohner selbst in den ärmsten Regionen der Volksrepublik kommen inzwischen auf umgerechnet 4,60 Dollar.
Behrens fand wunderbare Beispiele, die diese Entwicklung illustrieren. In Ningxia, einem autonomen Gebiet der Hui, lebten etwa 20 000 Familien vom Pilzanbau. Die Pilze für den Verzehr und für die medizinische Verwendung wuchsen auf alten Baumstämmen in Lehmhöhlen. Das Holz schlugen die Bauern in den ohnehin ausgedünnten Wäldern im Übergang zum mongolischen Steppen- und Wüstenland und wurden dennoch nicht reich. Was jedoch nicht an den Forstbehörden und Umweltschützern lag, die gegen die Abholzerei Front machten.
Es nahte Hilfe von der Agrar- und Forst-Universität in der Provinz Fujian an der Südostküste. Die hatten etwas gezüchtet, das sie als Alternativsubstrat anboten. Juncao heißt das bis zu fünf Meter in die Höhe wachsende Hybridgras, ein hochwertiges Futtermittel, das mehrmals im Jahr geerntet, als Biomasse zur Energieerzeugung und als Rohstoff in der Industrie genutzt werden kann. Zudem dient es zur Eindämmung der Wüsten, als Windschutz und zur Sanierung kontaminierter Böden. Und eben als Substrat für die Pilzzucht. Das heißt: Durch Wissenschaft erfolgte ein Quantensprung. Juncao trug nicht nur in Ningxia zur Hebung des Lebensstandards der Pilzbauern bei – das Wundergras, diese multifunktionale Nutzpflanze, wächst inzwischen auch in vielen anderen Entwicklungsländern.
Uwe Behrens legt mit seinem üppig illustrierten, inzwischen dritten Buch einen multifunktionalen Reisebericht vor, in welchem man viele Dinge erfährt, die bisher in keiner deutschen Zeitung standen. Warum? Siehe oben.
Uwe Behrens: Chinas Gegenentwurf. Ein Weg in die Zukunft. Edition Ost, 256 S., br., 20 €.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.