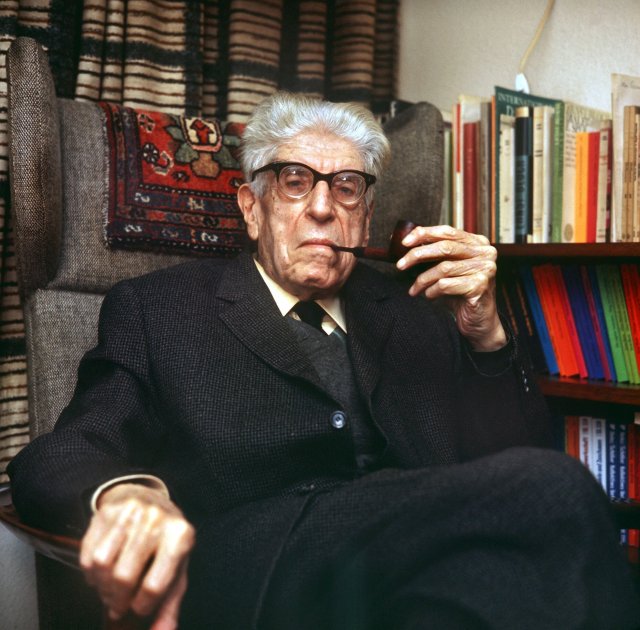- Kultur
- Rilkes Geburtstag
»Hiersein ist herrlich«
Vor 150 Jahren wurde Rainer Maria Rilke geboren. In der Schweiz löste sich seine »innerste Erstarrung«, erzählt Gunnar Decker

Am 11. Juni 1919 verließ Rilke Deutschland. Eine Rückkehr schloss er aus. Er hatte die letzten Jahre in München verbracht, hatte dort erleichtert das Ende des Krieges und die Revolution erlebt und danach mit Entsetzen den rechten Terror nach der Niederschlagung der Räterepublik. Nun gab es kein Zögern mehr. In einem »militaristisch gezwungenen Volke«, hatte er schon im November 1918 bekannt, könne er seine Zukunft nicht beginnen. Er hasse dieses Volk, schrieb er empört, »welches Un-Wesen … Kein Volk, kein Volk! Eine zu jedem Auftrieb des Großthuns brauchbare Masse; gleichgültig gegen jede Idee …«
Bereits im letzten Herbst hatte man ihn nach Zürich zu einer Lesung eingeladen. Der Schweiz, immer nur als »Durchgangsland« gesehen, war er so lange mit einer Art von Misstrauen gegen seine zu berühmte, zu deutliche, zu anspruchsvolle »Schönheit« begegnet, und wenn er mit dem Zug durchs Land fuhr, zog er die Vorhänge zu. Doch das änderte sich jetzt. Die Schweiz, bekannte er etwas später, war seine Rettung. Sie war verschont geblieben von »allem Wirrsal der Kriegsjahre« und auch »ein Fortschritt in mancher Weise«.
Flankiert von zwei reizenden, reich illustrierten Bändchen der Insel-Bücherei, Sandra Richters und Anna Kinders »Rilke als Gärtner« sowie Angelika Overaths und Manfred Kochs »Rilkes Tiere«, widmet sich der dritte, im Format etwas größere Band zum heutigen 150. Geburtstag des Dichters den letzten sieben Jahren, die Rilke, von Reisen nach Paris oder Venedig unterbrochen, in der Schweiz verbracht hat. Gunnar Decker, der sich schon zweimal in die Lebenswelt des singulären Poeten vertiefte, mit der Porträtgalerie »Rilkes Frauen« und einer großartigen Biografie, krönt die Liebe zum Sprachzauberer mit einer feinen, wunderbar leichten und eindringlichen Erzählung, die die »etappenweise Annäherung« an die Schweiz mit allen Stationen beschreibt: von Nyon über Locarno und Soglio bis zum Schloss Berg am Irchel und zum Château Muzot.
Es dauerte, bis sich Rilke in der Fremde einigermaßen heimisch fühlen und von seiner »Wahlheimat« sprechen konnte. Wirklich nah, sagt Decker, ist er den Eidgenossen trotzdem nicht gekommen. Zwei Jahre lang reiste er durchs Land, ohne einen festen Wohnsitz zu finden, immerzu müde, unruhig und immer mit der Sehnsucht nach Stille und einer Möglichkeit, fern von allen Störungen zu den »Duineser Elegien«, seinem »Herz-Werk«, zurückkehren zu können.
Inzwischen waren zehn Jahre vergangen, seit er im Januar 1912 in Duino, im Schloss seiner Gönnerin Marie von Thurn und Taxis hoch überm Golf von Triest, die erste Elegie schrieb mit der Zeile »Denn bleiben ist nirgends«. Im November 1915 war noch die vierte Elegie entstanden, aber da lebte man schon in den düsteren Jahren des Krieges, er wurde gemustert, ins Kriegsarchiv abkommandiert, erst nach einer Intervention aus dem Militärdienst entlassen und verbrachte die nächste Zeit wieder in München. Gezeichnet von einer »grausamen Gegenwart« war an die Vollendung seines Werks nicht zu denken. Er litt und war im Juni 1921 schon entschlossen, die Elegien als Fragment herauszugeben. »Um Gotteswillen«, intervenierte Marie von Thurn und Taxis, »tun Sie das nicht«. Und riet ihm, geduldig zu warten: »ich weiß, daß es kommen muß.«
Das Wunder geschah dann doch noch: Rilke entdeckte im Juni 1921 oberhalb von Sierre das Château Muzot »mit Ausblicken ins Thal, auf die Berghänge und in die wunderbarsten Tiefen des Himmels«, einen Turm, »dessen Gemäuer bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht«. Dieses »Schlößchen« mit seinen dicken Mauern, schrieb Rilke in einem langen Brief, hat »etwas Ehrlich-Bäurisches, Rüdes«. Es gab kein Licht und keinen Wasseranschluss, dafür Mängel über Mängel. Freund Reinhart sprang ein, übernahm die Renovierungskosten, und so war der Platz endlich gefunden, der die ersehnte Ruhe versprach. Rilke, meint Gunnar Decker, »hat sich in das Bild von Muzot verliebt, fast wie Narziss in sein eigenes Spiegelbild, als er ins klare Wasser einer Quelle blickte. So geht es Rilke, wenn er auf Muzot schaut – er sieht sich selbst.«
Die Muzot-Kapitel gehören zu den schönsten Seiten des Bändchens. Natürlich war Rilke nun mehr denn je auf tägliche Hilfe angewiesen. Immer waren Frauen um ihn, die ihn bewunderten und mit Freude dafür sorgten, dass es ihm an nichts fehlte. Hier jedoch, in Muzot, brauchte er eine Haushälterin, die die Einkäufe erledigte und den Berg hinaufschleppte, für ihn kochte und sorgte. Gefunden wurde Frida Baumgartner, eine Schweizerin aus Solothurn, das Geistlein, wie er sie nannte, Mitte zwanzig, nur leider nicht in der Lage, ihm ein veganes Mittagsmahl zuzubereiten (was ihr erst beigebracht werden musste), zudem ungeheuer langsam, aber zu seiner Freude von schneller Auffassungsgabe. Man kannte sie bislang eher flüchtig, falls sie in den Biografien überhaupt erwähnt wurde.
Decker widmet ihr eine eindrucksvolle Studie und zeigt dabei den Hausherrn von einer Seite, die man so noch nicht kannte: Er hat sich in Briefen zuweilen über sie beschwert, aber er mochte sie immer mehr. Sie war wortkarg und störte ihn nicht, und er fing an, ihr als Zeichen der Zuneigung Bücher zu schenken. Die Vorstellung, dass sie ihn verlassen könnte, schreckte ihn so, dass er sich ein Leben in seinem Turm nicht mehr vorstellen konnte, und als sie sich im Herbst 1925 wirklich von ihm trennte, offenbarte sich, dass sie unersetzbar war.
Rilke, der es gewohnt war, in vornehmen Hotels und Schlössern zu leben, ist in seiner kargen Walliser Behausung immer anspruchsloser geworden. »Muzot ist schwer«, gestand er, vor allem in den kalten Wintern, aber Muzot hat ihn schließlich auch von einer ungeheuren Last befreit. Plötzlich löste sich die »innerste Erstarrung«, und von einem »namenlosen Sturm« erfasst, vollendete er nach eigenem Bekenntnis in »wenigen Wochen unbeschreiblicher Hingebung« seine »Duineser Elegien«. Darin der Vers: »Hiersein ist herrlich.« Gleichzeitig entstanden die ersten »Sonette an Orpheus«.
Decker entwirft voller Empathie ein dichtes, beeindruckendes Porträt des alternden Dichters, der eines Tages Muzot abrupt verließ, über acht Monate in Paris blieb, dann genauso plötzlich zurückkehrte, gefoltert von »widerwärtigsten Krampf-Schmerzen« in Bad Ragaz Linderung von den Beschwerden suchte, im Sommer 1926 noch einmal ein Dutzend Gedichte in französischer Sprache schrieb und schließlich, Anfang Dezember, erfuhr, dass er an einer unheilbaren Form von Leukämie litt.
In einem Brief vom 15. Dezember hat Rilke über »die grausamsten, im ganzen Körper versprengten Vorgänge« berichtet und wie er lernte, sich »mit dem inkommensurabeln anonymen Schmerz« einzurichten, dem er »nie recht ins Gesicht sehen mochte«. »Lerne es schwer«, schrieb er, »unter hundert Auflehnungen, und so trüb erstaun«. Ihm blieben bloß noch zwei Wochen. Am 29. Dezember 1926 starb er. Und wurde am bitterkalten 2. Januar 1927 im Beisein weniger Freunde, wie er’s gewünscht hatte, an der Mauer der kleinen, hoch gelegenen Kapelle des Friedhofs von Raron begraben.
Den Bericht über Rilkes Sterben (»es ist zu arg, wie er leiden mußte«) hat Nanny Wunderly-Volkart, die Vertraute seiner letzten Jahre, überliefert. Decker geht auf den ergreifenden Brief, den sie an Gudi Nölke in Meran schickte, nicht weiter ein, zitiert aber neben ihrer Bemerkung, dass er dort oben in Raron »alle Weite und alles Licht« habe, den Satz: »Ich bin so stolz, daß er in unserer Schweizer Erde ruhen wollte.«
Gunnar Decker: Rilke in der Schweiz. Insel, 144 S., geb., 18 €.
Sandra Richter und Anna Kinder: Rilke als Gärtner. Insel, 112 S., geb., 16 €.
Angelika Overath und Manfred Koch: Rilkes Tiere. Insel, 112 S., geb., 16 €.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.