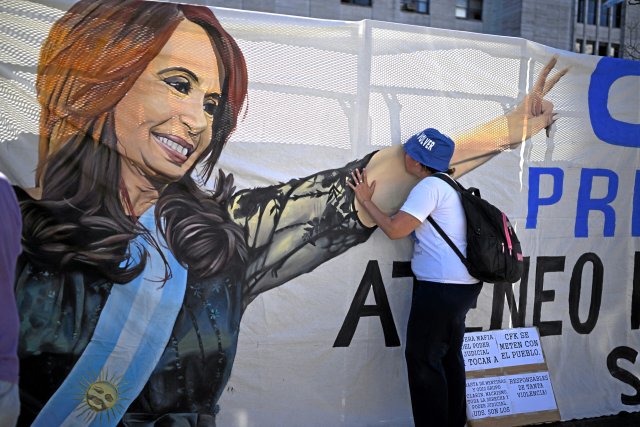- Politik
- Kommunalwahl NRW
BSW: »Wir wollen den etablierten Parteien auf die Finger hauen«
BSW will in NRW in Stadtparlamente und Bezirksvertretungen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wird zur Kommunalwahl in NRW in 32 Kreisen und Städten antreten. Zudem laufe der Aufbau der Partei im bevölkerungsreichsten Bundesland genau ein Jahr nach dessen Gründung derzeit gut.
»Das BSW ist dabei, sich flächendeckend in NRW mit Kreisverbänden aufzustellen«, sagte Amid Rabieh, NRW-Landeschef und stellvertretender Parteichef des BSW, dem »nd«. Rabieh sprach von einer vierstelligen Mitgliederzahl in NRW, die man bis Ende des Jahres erreichen wolle.
Auf einer Wahlkampfveranstaltung der Partei am Donnerstag in Duisburg, zu der auch Parteigründerin Sahra Wagenknecht kam, warb das BSW für soziale Gerechtigkeit, Abrüstung und Frieden. Sahra Wagenknecht sprach vor knapp 250 Zuhörern in der Duisburger Innenstadt von »frischem Wind«, den man in die Parlamente wehen möchte. Und davon, dass die Kommunalwahl ein Signal für die Bundespolitik sei. »Wir wollen die Bundespolitik stören. Wir wollen den etablierten Parteien auf die Finger hauen.«
Dass das BSW in NRW flächendeckend etabliert ist, sei kein leichter Weg gewesen. »Viele Schwierigkeiten hatten wir bei den Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen«, sagte Wagenknecht. Angeblich seien die Medien nicht auf der Seite des BSW gewesen, zudem mussten die Parteimitglieder auch erst mühsam Unterschriften sammeln, da die Partei nicht dem Bundestag angehöre. »Für jeden einzelnen Direktkandidaten im jeweiligen Wahlbezirk mussten Unterstützungsunterschriften, insgesamt mehr als 30 000 Unterschriften in NRW, her«, erklärte Rabieh am Rande der Veranstaltung gegenüber »nd«. Das sei eine »große Herausforderung für unsere ehrenamtlichen Mitglieder« gewesen. In diesem Zusammenhang kritisierte Hauptrednerin Sahra Wagenknecht erneut die Auszählung bei der vergangenen Bundestagswahl im Februar. Das BSW sieht sich um Stimmen betrogen, die den Einzug ins Hohe Haus ermöglichen könnten, und klagte dagegen – bislang erfolglos. Bei einer Forsa-Umfrage im Auftrag nordrhein-westfälischer Tageszeitungen gaben zwei Prozent der Wähler an, bei der Kommunalwahl für das BSW stimmen zu wollen. Der NRW-Trend des WDR sah die Partei zuletzt bei drei Prozent.
Kämpferisch gaben sich Christian Leye, selbst Duisburger und seit Parteigründung vor knapp anderthalb Jahren Generalsekretär des BSW, und Amid Rabieh: »Nur das BSW ist eine Alternative zu den Altparteien. Wir sind grundsätzlich anders«, sagte Leye. Ähnlich äußerte sich auch Rabieh.
Immer wieder wurde betont, dass das BSW sich für die Belange der Bürger in den kommunalen Parlamenten starkmacht. Mit immer denselben Themen und Forderungen: bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Kommunalverwaltungen besser finanziell auszustatten, die regionale und lokale Infrastruktur zu stärken und vor allem Altersarmut zu bekämpfen. »Das Geld ist da für eine gerechtere Politik«, sagte Leye. Das Geld werde nur falsch eingesetzt. Weil wirtschaftliche Interessen das Land regierten und die Politik zu selten Rahmenbedingungen schaffe, mahnte Rabieh.
Wenn Merz Milliarden für Rüstung ausgibt, aber kaum Geld für Bildung, Infrastruktur und Altersvorsorge bereitstellt, erzürnt das die Gemüter des BSW. Und nicht nur die. Die Menschen fühlten sich von der herrschenden Politik über den Tisch gezogen. »Merz gibt 19,6 Milliarden Euro für die Ertüchtigung des Militärs aus statt für den Sozialstaat, das ist asoziale Marktwirtschaft«, kritisierte Rabieh. So würden die sozialen Probleme nicht nur an Rhein und Ruhr verschärft. Rund 55 Milliarden Euro beträgt die Schuldenlast allein in NRW. Oft seien die Kommunen die Leidtragenden einer verfehlten Politik im Bund. Die Probleme würden einfach runtergegeben, vom Bund in die Kommunen, beklagte Leye.
Leye setzte sich auch für einen Staatseinstieg bei dem angeschlagenen Stahlunternehmen ThyssenKruppSteelEurope ein und nennt England als mögliches Vorbild. Dort hat die britische Regierung die Kontrolle über British Steel, insbesondere über das Werk in Scunthorpe, übernommen, um strategische nationale Projekte wie Flughäfen, den Schienenverkehr und den Wohnungsbau zu versorgen und die heimischen Lieferketten zu stärken. Besonders in Duisburg, der selbsternannten Stahlstadt, wird ein Einstieg des Staates von vielen befürwortet, denn das könnte Arbeitsplätze, auch bei Zulieferern, retten. Bis zu 11 000 Arbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren in Duisburg und an anderen Thyssenkrupp-Standorten abgebaut werden. Die Zukunft des einst größten Stahlstandorts der Welt ist trotz bereits geflossener Milliarden von Bund und Land ungewisser denn je.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.