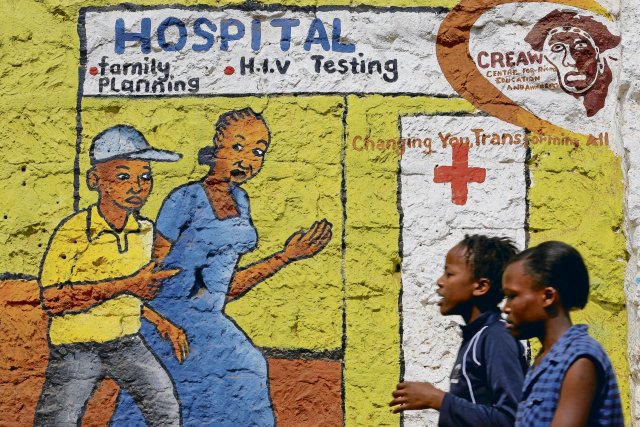- Wirtschaft und Umwelt
- Finanzpolitik
Die Unwucht des Steuersystems
Die neue Debatte über höhere Abgaben für Spitzenverdiener dreht sich zu sehr um die Einkommensteuer

Der »Herbst der Reformen« rückt heran. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte ihn bereits im Frühsommer ausgerufen. Nun neigt sich der Sommer seinem Ende zu, und die Spitzen von Union und SPD trafen sich Ende der Woche erstmals wieder zu einer Fraktionsklausur. Am 8. September beendet dann auch der Bundestag seine Sommerpause. Finanzminister Lars Klingbeil schließt mit Blick auf die Fiskalpolitik dann keine Option aus. Der SPD-Vorsitzende hatte zuletzt mehrfach gefordert, auch über höhere Steuern für Menschen mit sehr hohen Einkommen oder Vermögen nachzudenken.
Die Unionsspitzen waren bislang gegen jede Art von Steuererhöhung und verwiesen auf den Koalitionsvertrag. Doch aus der Union kommen nun erstmals Signale, dass höhere Steuern für Spitzenverdiener doch möglich wären. Der CDU-Haushaltsexperte Andreas Mattfeldt zeigt sich offen für eine Anhebung der sogenannten Reichensteuer – wenn die SPD im Gegenzug Sozialreformen zustimmt. Mattfeldt sagte »Bild«, er habe mit Personen gesprochen, die mehr als eine halbe Million Euro im Jahr verdienten. Deren Antwort sei stets gewesen, dass sie kein Problem mit einer höheren Steuer hätten, wenn echte Reformen folgen würden.
Derzeit liegt die Reichensteuer in Höhe von 45 Prozent für Bezieher von Einkommen über 278 000 Euro pro Jahr drei Punkte über dem regulären Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Größere Haushaltslöcher ließen sich mit einer Erhöhung allerdings kaum stopfen. Trotz stark steigender Neuverschuldung und im ersten Halbjahr überraschend hoher Steuereinnahmen kann Finanzminister Klingbeil mittelfristig die Lücken in seinem Haushalt nicht schließen. Bis 2029 wachsen sie laut Etatentwurf auf mehr als 170 Milliarden Euro. Eine Anhebung der Reichensteuer auf 48 Prozent würde nach einer Schätzung der vorherigen Bundesregierung lediglich zu Mehreinnahmen von drei Milliarden Euro führen. Einträglicher wäre eine Steuererhöhung, welche die obersten zehn Prozent der Steuerpflichtigen zahlen müssten. Die Gruppe der Bürger mit einem jährlichen Einkommen von mehr als 87 162 Euro zahlt allerdings bereits 190 Milliarden Euro und damit 56,9 Prozent aller Einkommensteuern.
Laut der Forschungsgruppe Wahlen stimmen zwei Drittel der Bürger dafür, höhere Einkommen und Vermögen stärker zu besteuern.
Mit Blick auf Klingbeils Aussagen stellt sich daher die Frage, welche Arten der Besteuerung eingesetzt werden sollen. An einer weiteren Belastung des Faktors Arbeit gibt es grundlegende Bedenken auch von linken Ökonomen. Werden breite Schichten mit höheren Einkommensteuern belastet, führt dies zu Ausweichbewegungen, etwa zu mehr Teilzeitarbeit. Auch die Rekrutierung von Fachkräften aus der Eurozone würde für Unternehmen dadurch schwieriger werden. In den kommenden Jahren steigen außerdem absehbar die Beiträge, die Beschäftigte und Unternehmen für Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung zahlen. Höhere Lohnnebenkosten und Einkommensteuern könnten die Wettbewerbsfähigkeit besonders arbeitsintensiver Branchen wie Handwerk und Gaststätten sowie der exportorientierten Industrie schwächen.
Wie ihre Vorgänger setzt die Bundesregierung Merz bisher trotzdem auf höhere Sozialabgaben auf Arbeit. Dagegen wird das 2009 eingeführte Privileg der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge – sie beträgt lediglich 25 Prozent und steigt nicht mit höherem Vermögen – zum Leidwesen linker Ökonomen im Koalitionsvertrag nicht infrage gestellt.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Unwucht des Steuersystems habe zu einer neuen Gesellschaftsstruktur geführt, kritisiert der deutsche Soziologe Robert Dorschel, der an der englischen Universität Cambridge lehrt. »Wer über Aktienvermögen verfügte, konnte sich in den vergangenen Jahrzehnten über starke Kursgewinne freuen.« Daneben konnten auch Immobilieneigentümer seit der Finanzkrise 2007/08 massive Vermögensgewinne verbuchen. Das habe zu einer ökonomischen Spaltung der Mittelschicht geführt.
Eine Möglichkeit, um mehr Geld für eine Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme, für Investitionen in Bildung und Infrastruktur sowie eine umweltverträglichere Modernisierung Deutschlands zu erzielen, könnte die Erbschaftsteuer bieten. Das Problem aus Sicht von Klingbeil: Das Aufkommen daraus steht den Bundesländern zu und ist zudem in der Summe überschaubar. Vor allem, weil das »Schonvermögen« für Betriebe verhindert, dass Firmenerben Erbschaftsteuer zahlen.
Reichen in die Tasche zu greifen stößt allerdings in weiten Teilen der Gesellschaft auf Sympathie. Laut der Forschungsgruppe Wahlen stimmen zwei Drittel der Bürger dafür, höhere Einkommen und Vermögen stärker zu besteuern. Da es wenig Sinn macht, Firmen und Arbeitsplätzen durch eine radikale Erbschaftsteuerregelung den Boden unter den Füßen wegzureißen, wäre die naheliegende Alternative eine Wiedererhebung der Vermögensteuer.
Wirtschaftssoziologe Dorschel bringt zudem eine einmalige Vermögensabgabe ins Spiel, die über viele Jahre hinweg abgezahlt werden kann. Sie würde Firmeneigentümer und Hausbesitzer nicht zum Verkauf zwingen und wäre rechtlich leichter realisierbar als eine dauerhafte Steuer. In der Bunderepublik hat es das schon mal gegeben: 1952 beschloss die CDU-geführte Bundesregierung von Konrad Adenauer eine über 25 Jahre zu entrichtende, einmalige Vermögensabgabe, um die materiellen Folgen von Krieg und Flucht zu mildern.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.