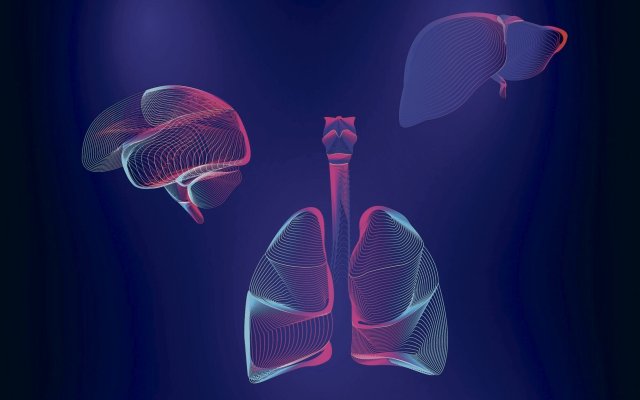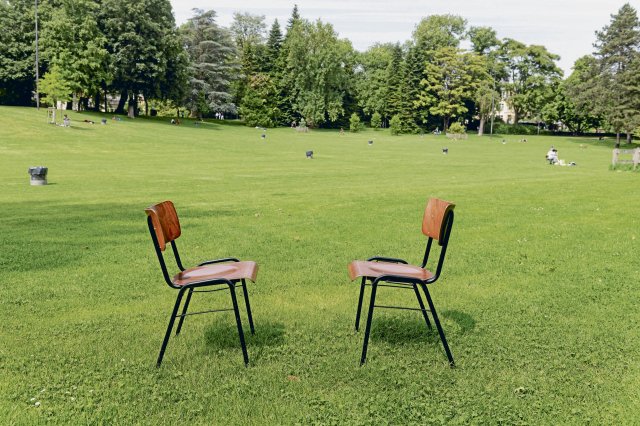- Wissen
- Flugverkehr
Klimabilanz der Luftfahrt: Die Streifen müssen weg
Durch veränderte Flugrouten und neue Kraftstoffe ließe sich die Klimabilanz der Luftfahrt verbessern

Fliegen Verkehrsflugzeuge bei strahlend blauem Himmel in großer Höhe, bilden sich hinter den Maschinen häufig weiße Streifen, die noch lange zu sehen sind. Die so entstandenen Kondensstreifen können in Höhen von acht bis zwölf Kilometern mehrere Stunden bestehen. Mit der Zeit bilden sie hohe Wolken, die als Kondensstreifen-Zirren bezeichnet werden. Diese setzen sich aus winzigen Eiskristallen zusammen und sind besonders klimawirksam.
CO2 gilt nach landläufiger Ansicht auch im Luftverkehr als Hauptfaktor für den Anteil des Menschen am Klimawandel. Aber das ist gar nicht so – wie schon 2020 eine umfangreiche internationale Studie der Manchester Metropolitan University unter Beteiligung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ergeben hat. Grundsätzlich hat demnach die globale Luftfahrt einen Anteil von 3,5 Prozent an der menschengemachten Klimaerwärmung. Aber nur ein Drittel der Klimawirkung des Luftverkehrs beruht auf CO2-Emissionen. Zwei Drittel entfallen auf sogenannte Nicht-CO2-Effekte. Dazu gehören unter anderem Ozon, Aerosole, Stickoxide und Kondensstreifen. Diese – und die sich daraus entwickelnden Kondensstreifen-Zirren haben dabei den größten Anteil. Daraus folgt: Wer die klimaschädliche Wirkung des Luftverkehrs reduzieren will, hat bei Kondensstreifen dazu den größten Hebel.
Kälte plus Luftfeuchtigkeit
Wie entstehen Kondensstreifen? Dazu ist eine Kombination von tiefen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit nötig, das sogenannte Schmidt-Appleman-Kriterium. Die Temperatur muss zwischen Minus 35 und 55 Grad Celsius liegen. Gleichzeitig darf die Luft nicht zu trocken sein, weil sich die Kondensstreifen sonst schnell wieder auflösen. Verbrennt Kerosin in Düsentriebwerken, entstehen pro Kilogramm Treibstoff 1,23 Kilogramm Wasserdampf, 3,15 Kilogramm CO2 – und Myriaden winziger Rußpartikel. Verlassen diese das Triebwerk, verklumpen sie schnell und bilden Kondensationskeime für kleine, unterkühlte Wassertropfen. Diese gefrieren zu Eiskristallen. Hinter dem Flugzeug bilden sich Kondensstreifen und werden von den dort vorhandenen Wirbeln in die Breite gezogen.
Das DLR forscht seit Jahren international federführend an möglichen Lösungen. Grundsätzlich lassen sich Kondensstreifen und damit ihre klimaschädliche Wirkung auf zwei Wegen deutlich reduzieren.
Fachleute unterteilen grob drei Generationen nachhaltigen Kerosins. Zur ersten gehören Kraftstoffe, die aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen erzeugt wurden. Die zweite beinhaltet Kerosin, dessen Ausgangsstoff sowohl pflanzliche als auch tierische Altöle und -fette sind. Dazu gehört gebrauchtes Fett aus Fritteusen. Zur dritten Generation gehört E-Fuel. Es wird synthetisch produziert und den sogenannten Power-to-Liquid-Kraftstoffen zugerechnet, die aus Wasser, Ökostrom und CO2 hergestellt werden.
Ein Lösungsansatz liegt in der Optimierung der Flugrouten, sodass die Maschinen möglichst viel unter Umgebungsbedingungen fliegen, die die Entstehung von Kondensstreifen gar nicht erst möglich machen. Das ist nicht nur Theorie, sondern funktioniert auch in der Praxis. DLR und das Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) haben gemeinsam nachgewiesen, dass sich langlebige Kondensstreifen durch vergleichsweise kleine Veränderungen der Flughöhe vermeiden lassen. Entsprechende Testflüge fanden während der Corona-Pandemie statt, in der der Luftverkehr weltweit drastisch eingeschränkt war. Das bot ideale Bedingungen für Analysen im oberen Luftraum über den Benelux-Staaten und Nordwestdeutschland.
Sagten die Wetterberichte langlebige Kondensstreifen voraus, wurden die Maschinen bei den Testflügen um rund 600 Meter nach oben oder unten umgeleitet. An anderen Tagen mit diesen Bedingungen flogen die Flugzeuge ohne Eingriff in die Flughöhe. Per Satellit wurden die Ergebnisse aus großer Höhe überwacht, vergleichbar gemacht und dokumentiert. Und tatsächlich ergaben die Versuche eine deutliche Verringerung der Kondensstreifen-Bildung durch die Flughöhenanpassung.
Änderung der Flughöhe lohnt sich
Noch sind Fragen offen: So sind zur Veränderung der Flughöhe oft Steigflüge nötig. Dadurch verbraucht das Flugzeug etwas mehr Kerosin und erzeugt mehr CO2. Der Nachteil dadurch sollte geringer sein als der Vorteil durch die verminderte Kondensstreifenbildung. Weiter muss sicher sein, dass die Veränderung von Flughöhen und -routen weder die Sicherheit noch die Kapazität des Luftraums beschränkt. Geklärt werden diese Fragen unter anderem im Forschungsprojekt D-Kult. Die Abkürzung steht für Demonstrator Klima- und Umweltfreundlicher Lufttransport. Daran arbeiten unter anderem das DLR, der Deutsche Wetterdienst, die Deutsche Flugsicherung, Fluggesellschaften und IT-Dienstleister.
Kondensstreifen-Zirren setzen sich aus winzigen Eiskristallen zusammen und sind besonders klimawirksam.
Die Fluggesellschaft Etihad hat bereits am 23. Oktober 2023 gezeigt, dass sich auch im Alltagsbetrieb Flüge durchführen lassen, bei denen Flughöhe und -route hinsichtlich Kondensstreifenbildung optimiert sind. An diesem Tag führte Flug EY20 der Airline von London nach Abu Dhabi. Airline-Mitarbeiter hatten in Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen SATAVIA Regionen in der Atmosphäre identifiziert, in denen die Bildung von Kondensstreifen zu erwarten war und die Flugroute entsprechend angepasst. Ergebnis des Fluges: Aufgrund der leicht veränderten Route entstand ein Mehrverbrauch von 100 Kilogramm Kerosin. Das entspricht nach Angaben der Airline 0,48 Tonnen CO2. Rechnerisch wurden so bei diesem Flug 64 Tonnen CO2 eingespart.
Der andere Ansatz zur Reduzierung der Kondensstreifen besteht in der Verminderung der Rußpartikel im Kerosin. Je weniger Ruß vorhanden ist, umso weniger Eis bildet sich im Abgasstrahl und umso kleiner sind die Kondensstreifen. Kerosin wird aus Rohöl hergestellt. Neben verschiedenen Kohlenwasserstoffen wie Paraffinen oder Cycloparaffinen enthält Kerosin ringförmige Kohlenwasserstoffe. Fachleute sprechen auch von Aromaten. Diese »verursachen bei ihrer Verbrennung mehr Rußpartikel als kurzkettige Kohlenwasserstoffe«, wie Patrick Le Clercq vom DLR-Institut für Verbrennungstechnik in Stuttgart erklärt. Wäre es möglich, Kerosin ohne ringförmige Kohlenwasserstoffe herzustellen, ließe sich die Bildung von Rußpartikeln im Abgas von Flugzeugen deutlich reduzieren.
Genau das ist machbar. Und es funktioniert nicht nur in der Theorie. Solches Kerosin gibt es bereits. Es wird als Sustainable Aviation Fuel (SAF) bezeichnet und aus regenerativen Quellen hergestellt. Dazu bedarf es keines Erdöls. SAF hat einen geringeren CO2-Fußabdruck als das herkömmlich erzeugte Kerosin.
Weniger Ruß durch Treibstoffwechsel
SAF lässt sich auf unterschiedliche Arten herstellen. In vielen Fällen wird es aus Abfällen produziert, in anderen aus Pflanzen. Bei aktuellsten Verfahren wird SAF aus regenerativen Energien zum Beispiel mithilfe von Windstrom gewonnenem »grünem« Wasserstoff hergestellt – und als E-Fuel bezeichnet. »Alle diese nachhaltigen Kraftstoffe haben gemeinsam, dass sie ohne zyklische Kohlenwasserstoffe, sogenannte Aromate, produziert werden können«, erläutert Patrick Le Clercq. »Weniger Aromate im Kraftstoff bedeutet weniger Ruß in den Emissionen und damit weniger Eiskristalle in den Kondensstreifen. Damit verringern nachhaltige Kraftstoffe die beiden größten klimaerwärmenden Effekte der Luftfahrt, Kondensstreifen und den CO2-Fußabdruck.«
Der Passagierflugverkehr ist nach Angaben der International Air Transport Association IATA im Jahr 2024 erstmals auf ein größeres Volumen als im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie gewachsen. Gemessen in Fluggastkilometern waren dies 3,8 Prozent mehr als 2019. Für 2025 wird ein weiteres Wachstum erwartet. Laut einer Auswertung des Unternehmens atmosfair von 2024 reichen bisherige Effizienzverbesserungen nicht aus, um das Wachstum des Flugverkehrs zu kompensieren. Dafür wäre eine Effizienzsteigerung um vier Prozent jährlich nötig, erzielt wurden seit 2019 aber nur 1,4 Prozent pro Jahr. SAF machten bislang maximal ein Prozent des Treibstoffverbrauchs einer Airline aus. jbl
Bereits 2018 hat das DLR zusammen mit der US-Weltraumbehörde Nasa Flugversuche zu diesem Thema durchgeführt. Dabei wurde ein Airbus zum einen mit herkömmlichem Kerosin betankt, zum anderen mit einer 50-50-Mischung von Kerosin und SAF. Die Versuche wurden vom DLR fortgeführt und schließlich ein Testflugzeug mit 100 Prozent SAF betankt. Als Referenz diente die Betankung mit 100 Prozent herkömmlichem Kerosin. Wie schon bei den Versuchen zuvor, folgte ein Messflugzeug. Die Ergebnisse dieser Flüge wurden kürzlich veröffentlicht. Sie zeigen einen kleineren Ausstoß von Rußpartikeln und eine um 56 Prozent geringere Anzahl an Eiskristallen in Kondensstreifen. Das führte zu einer Reduzierung der Klimawirkung von Kondensstreifen um 26 Prozent, wie das DLR in globalen Klimamodell-Simulationen errechnet hat.
Beimischungspflicht ab 2030
Der nächste Schritt wäre es jetzt, SAF in großem Maßstab im kommerziellen Luftverkehr einzusetzen. Bisher dürfen die neuen Kraftstoffe nur gemischt mit Kerosin zum Einsatz kommen. Bis zu 50 Prozent dürfen es sein. Solche Mengen sind aber aktuell noch nicht am Markt verfügbar. Das soll sich in Zukunft ändern und der SAF-Anteil bei Flügen in Europa schrittweise steigen. Ab 2030 ist eine Beimischung von fünf Prozent SAF gesetzlich vorgeschrieben. 2050 sollen es 63 Prozent sein.
Durch SAF lassen sich Kondensstreifen stark vermindern. Wenn dann noch die Flugrouten optimiert werden, dazu noch der ohnehin geringere CO2-Fußabdruck des SAF kommt und der geringere CO2-Ausstoß durch den technischen Fortschritt in Form zum Beispiel der Einführung moderner Triebwerke, ist der klimaerwärmende Effekt der Luftfahrt schon deutlich reduziert. Das soll eine Brücke schaffen, bis Elektroantriebe auf extremen Kurzstrecken und grüner Wasserstoff oder E-Fuel für den Antrieb auch auf längeren Strecken in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.