- Wissen
- Klimaschutz
Moore: Bäume, die im Wasser stehen
Moore in Deutschland sollen für den Klimaschutz renaturiert werden. Dazu zählen auch Moorwälder

Ist von Moor die Rede, denken viele Menschen an das klassische Hochmoor: Offenland, geprägt durch die charakteristische Vegetation von Torfmoosen, Rauschbeere und Wollgras. Tatsächlich dominieren in Deutschland jedoch die Niedermoore. Im Unterschied zu ersteren werden sie durch Quell- und Grundwasser gespeist und sind deutlich nährstoff- und artenreicher. Nur wenn das Wasser dauerhaft hoch steht, ist ein Moor natürlicherweise gehölzfrei. Bei einem Pegel von maximal zehn Zentimetern unter Flur gedeihen darauf bereits Schwarzerlen. Bei niedrigerem Wasserstand finden sich auch Sumpfbirken und Fichten sowie auf Bodenerhebungen, sogenannten Bulten, Spirken (Moorkiefern) und Waldkiefern.
Nur noch fünf bis zehn Prozent der deutschen Moore sind hydrologisch intakt. Die meisten wurden in den vergangenen 150 Jahren trockengelegt, um darauf Land- und Forstwirtschaft zu betreiben. Doch indem Sauerstoff in den Boden gelangt, bauen Mikroben das organische Material ab, das sich dort unter Luftabschluss über Jahrtausende angereichert hat. Der im Torf gespeicherte Kohlenstoff entweicht in die Atmosphäre. So verwandeln sich die organischen Böden in Kohlenstoffquellen: In Deutschland produzieren sie 7,5 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen.
So hatte sich bereits die Ampel-Regierung in ihrer Moorschutzstrategie verpflichtet, im Zuge des Klimaschutzes möglichst viele Moore in Deutschland wieder zu vernässen, darunter auch bewaldete Moorflächen, die sogenannten Moorwälder. Denn obwohl sie nur einen winzigen Teil der Waldfläche Deutschlands ausmachen, stellen sie wichtige Kohlenstoffsenken dar. Wie ein jüngst vorgelegter Bericht im Rahmen des Projektes »Moorbodenmonitoring für den Klimaschutz (Momok)-Wald« des Thünen-Instituts zeigt, speichern sie im Durchschnitt über 1200 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. Hinzu kommen 90 Tonnen Kohlenstoff im Mittel aus dem Holz der Bestände.
»Im Wald reicht es nicht, alleine Gräben zu verfüllen.«
Nicole Wellbrock Forstwissenschaftlerin
Ziel des vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) in Auftrag gegebenen Projektes ist es, vergleichbare, flächendeckende Daten über den Treibhausgasausstoß der Moorwälder zu ermitteln, aus denen Maßnahmen für ihren Schutz abgeleitet werden können. Dafür wählten die Wissenschaftler*innen 50 bewaldete Moore aus, mit Torfschichten von 15 Zentimetern bis über 10 Meter. Erste Messreihen weisen Moorwälder derzeit als CO2-Quellen aus. Die Forscher*innen registrierten überdies lokal einen hohen, von offenen Wasserflächen verursachten Methanausstoß. Als Folge jahrelanger Entwässerung und schwankender Wasserstände bilden sich zudem deutlich messbare Emissionen klimawirksamen Lachgases.
Die Wiedervernässung von Moorwäldern ist komplex: »Anders als in der Landwirtschaft, wo man ein Wehr hat, das man schließt, reicht es im Wald nicht, alleine Gräben zu verfüllen«, erklärt die Forstwissenschaftlerin am Thünen-Institut, Nicole Wellbrock, die an Momok-Wald mitarbeitet. »Gerade an Hanglagen ist die Wiedervernässung eine Herausforderung.« Im Gegensatz zu Hochmooren, die Wasser wie ein Schwamm speichern können, muss bei der Renaturierung von Niedermooren der gesamte Landschaftswasserhaushalt einbezogen werden.
Stefan Müller-Kroehling, Forstwissenschaftler an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, spricht sich dafür aus, Moorwälder behutsam umzubauen. »Das Schöne in Deutschland ist, dass alle (auf entwässerten Flächen) eingesetzten Baumarten natürlicherweise an diesen Standorten vorkommen«, erzählt er. So wachse die Gemeine Fichte aufgrund ihrer hohen Kältetoleranz und ihrem flachen, weit ausladenden Wurzelteller natürlicherweise in Niedermooren, so etwa in den Aufichtenwäldern im Bayerischen Wald. »Damit hat man Ausgangsbestockungen, auf deren Grundlage man weiterarbeiten kann, indem man stufenweise vernässt«, erklärt Müller-Kroehling. Holze man alles ab, müsse man wieder bei null anfangen. Auch verlören die dort lebenden Tiere auf einen Schlag ihr Zuhause.
Bei der Moorwaldfauna handelt es sich um Spezialisten wie bestimmte Ameisenarten, winzig kleine Hornmilben oder Rüsselkäfer, die sich asexuell vermehren. Waldeidechse und Kreuzotter lieben ihrerseits Innenwaldränder und lichte, nadelbaumgeprägte Moorwälder, während Kraniche gerne in Erlenbruchwäldern brüten. Zu Zeiten des Klimawandels suchen aber auch Arten, die sonst im Offenland vorkommen, im Wald Schutz vor der Hitze.
Von zentraler Bedeutung seien dabei die Randwälder, die den Kern der Moore vor Winden und Austrocknung schützen, betont Müller-Kroehling. Diese gelte es zu »hüten wie einen Schatz«. Auch müsse unbedingt das lokale Eigenklima gestärkt werden, um Moore trotz der Erderwärmung zu halten. Größere Moorflächen verfügen sogar über ein eigenes Wetter: Indem dort Feuchtigkeit aufsteigt, bilden sich Wolken, die lokal wieder als Gewitter abregnen könnten.
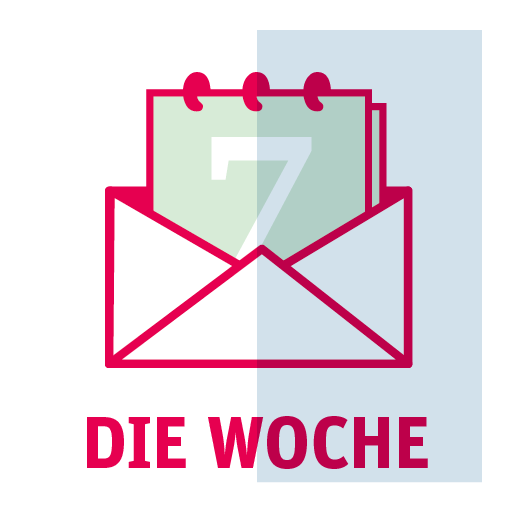
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Um Moorwälder zu renaturieren, braucht es Anreize für die Besitzer*innen, denn die Schwarzerle ist auf dem Holzmarkt nicht sehr wirtschaftlich. Auch erfordert die forstwirtschaftliche Nutzung völlig vernässter Moore spezielles Gerät. »Im Spreewald gibt es Orte, an denen mit Seilzug geerntet wird, aber das macht die Ernte sehr viel teurer«, berichtet Wellbrock. Rund die Hälfte aller deutschen Wälder befindet sich in Privatbesitz. Ähnlich wie bei landwirtschaftlich genutzten Flächen könnte eine Wiedervernässung durch Klimazertifikate gefördert werden oder indem Bund und Länder andere Flächen im Ausgleich anbieten. Die Böden müssen aber auch nicht per se vollständig wiedervernässt werden.
Insgesamt warnen die Expert*innen davor, den Klimabeitrag von Moorwäldern zu überschätzen: Eine Renaturierung der Flächen sei wichtig für die Biodiversität, für die Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts und um die großen, im Torf gespeicherten Kohlenstoffvorräte im Boden zu halten. Die Möglichkeit, neuen Kohlenstoff zu binden, schätzen sie dagegen eher gering ein. So führe kein Weg an umfassenden Emissionseinsparungen etwa im Verkehrs- und Gebäudesektor vorbei, mahnt Wellbrock.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.







