- Reise
- Estland
Narva – Stadt im Dazwischen
Fast alle hier sprechen Russisch, doch Estland schaut nach Westen. Narva trägt Spuren von Handel, Industrie und geopolitischer Spannung

»Wir befinden uns hier am äußersten Rand, an der Grenze von Zivilisationen«, sagt Allan Kaldoja mit grimmigem Vergnügen. Der Rechtsanwalt, Unternehmer und Theatergründer stammt aus Narva. Für ihn sind die beiden Festungen am Flussufer – die Hermannsfeste auf estnischer Seite, von Dänen im 13. Jahrhundert errichtet, und die Burg Iwangorod, die Zar Iwan der Schreckliche 1492 erbauen ließ – steinerne Manifestationen einer jahrhundertelangen Abfolge von Bedrohungen und Kriegen. »Ausländische Freunde schwärmen von diesem Anblick wie aus einem Märchen. Aber zwei Festungen, die sich direkt gegenüberstehen, haben immer einen Grund. Hier stößt Macht auf Macht.«
Heutzutage schießen keine Kanonen mehr. Stattdessen toben Propagandaschlachten. Am 9. Mai, dem russischen Gedenktag an den Sieg über den Faschismus, feierte Iwangorod mit Militärmusik. An der Mauer der Hermannsfeste prangte derweil ein riesiges Plakat: eine Collage mit den Gesichtern von Putin und Hitler, überschrieben mit »Putler. War Criminal«. Drastischer lässt sich Russlands Angriffskrieg kaum historisch verorten. Dass er am 24. Februar 2022, dem estnischen Nationalfeiertag, begann, wird im Baltikum als bewusstes Signal imperialer Ansprüche verstanden.
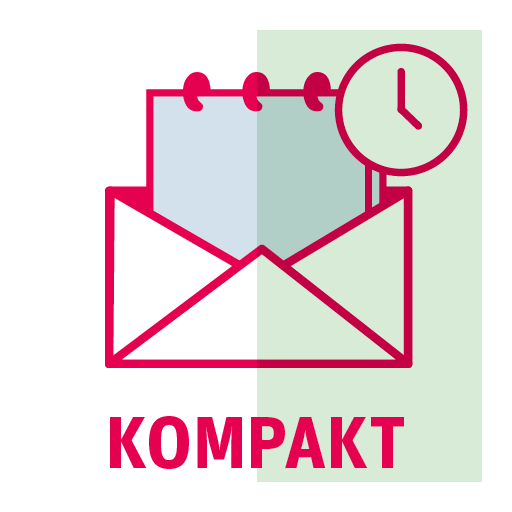
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Die russischste Stadt Estlands
In Narva spürt man diese Spannungen besonders intensiv. Rund 95 Prozent der Einwohner sprechen Russisch. Das ist Folge eines Bevölkerungsaustauschs nach dem Zweiten Weltkrieg: Nachdem die Rote Armee die Stadt 1944 zerstört hatte, durften Esten nicht zurückkehren. Für den Wiederaufbau wurden stattdessen Arbeitskräfte aus Russland abkommandiert.
Spuren dieser Zeit prägen das Stadtbild. An den Fassaden der riesigen Textilfabrik Kreenholm, die einst 12 000 Menschen beschäftigte, sind noch kyrillische Inschriften zu sehen. Ein Relief erinnert an einen Arbeiterstreik von 1872. Es zeigt eine Frau, die entschlossen aus der Menge heraustritt. Ganz korrekt ist das nicht – im 19. Jahrhundert arbeiteten vor allem Männer in der Fabrik, die der Bremer Unternehmer Ludwig Knoop gegründet hatte. Doch in der Sowjetzeit dominierten Frauen an den Maschinen. Das Denkmal ehrt sie. Das Lenin-Standbild, das unweit davon stand, wurde dagegen längst entfernt. Nur der Abdruck seines Sockels ist im Boden noch zu erkennen.
Kaum besser geht es einer kleinen Hängebrücke, die vom Werksgelände aus auf die andere Seite hinüberführt. Sie diente noch einige Jahre nach der Unabhängkeit Estlands dem kleinen Grenzverkehr. Inzwischen aber droht sie halb zerstört und vollkommen verwahrlost in den Fluss zu sinken.
Die mächtige Stahlbetonbrücke etwas weiter flussabwärts ist immerhin noch in Betrieb. Ihr Name »Brücke der Freundschaft« ist allerdings nicht mehr Programm: Die mehrspurige Fahrbahn ist durch Panzersperren unterbrochen. Nur noch zu Fuß gelangen einige Menschen auf mit Gittern abgesperrten Laufwegen von der einen Seite des Flusses auf die andere. Es handelt sich um Russen, die nach Europa wollen, um russischstämmige Einwohner Narvas, die mit dem grauen Pass Verwandte in Iwangorod besuchen oder gleich ganz zu einem Ausflug ins nur 150 Kilometer entfernte St. Petersburg aufbrechen.
In den ersten Monaten nach Ausbruch des Ukraine-Krieges war der Grenzübergang auch eines der wenigen Nadelöhre, über das verschleppte Ukrainerinnen und Ukrainer wieder aus Russland ausreisen konnten. »Da standen sie dann Ende März 2022 auf dem Platz hinter der Grenze, junge und alte Frauen, verkrüppelte Männer und gesunde, mit Kindern, Hunden und Katzen, und sie wussten nicht, wohin. Sie haben sich dann aber schnell organisiert. Und wir brachten in den acht Zimmern, die wir im Theater eigentlich als Unterkünfte für Schauspieler ausgebaut haben, von März bis August 2022 mehr als 1000 Menschen kurzzeitig unter«, erzählt Kaldoja.
Geheimfabrik für Bombe und Kosmos
Das Theater, das Kaldoja 2018 gründete, befindet sich ebenfalls in einer ehemaligen Industrieanlage. Sie war einst eine geheime Rüstungsfabrik, lediglich unter dem Kürzel »Postfach Nr. 2« bekannt. Hier wurden zunächst Teile für die sowjetische Atombombe und später für das Weltraumprogramm hergestellt. »Die Leute sagen, dass immer noch Teile aus der Fabrik im Weltraum herumfliegen«, erzählt die Dramatikerin Piret Jaaks. Sie sprach mit ehemaligen Arbeiterinnen und verdichtete deren Erinnerungen zu dem Stück »Internal Climate«, das im August beim Theaterfestival »Freiheit« uraufgeführt wurde.
Das Festival wird alle zwei Jahre unter dem Titel »Freiheit« veranstaltet. Angesichts der geopolitischen Lage Narvas verwundert diese Akzentuierung nicht. »In den letzten 500 Jahren estnischer Geschichte gab es stets zwei Phasen: Entweder wir wurden vom russischen Imperium okkupiert, oder es versucht, uns alle 30 bis 50 Jahre zu okkupieren«, meint Kaldoja trocken. Mit Galgenhumor fügt er hinzu: »Wir hatten sogar Glück. Denn als im Jahr 1700 der russische Zar Peter I. Narva belagerte, schlug ihn zum Glück der Schwedenkönig Karl XII. Peter gründete daraufhin Petersburg. Hätte er gesiegt, hätte er in Narva oder vielleicht auch in Tallinn seine neue Residenzstadt an der Ostsee gegründet und Estland wäre im russischen Reich aufgegangen.«

Für Kaldoja, der selbst zu einem Viertel russischer Herkunft ist, sich aber schon in den 90er Jahren für die Unabhängigkeit Estlands einsetzte, sind diese historischen Bezüge immer noch voller Aussagekraft. Und ganz falsch liegt er anhand der immer wieder geäußerten imperialen Ansprüche Moskaus sicher nicht. Geradezu melancholisch erzählt er vom Kulturleben zu sowjetischen Zeiten im Badeort Narva-Jõesuu, etwa 15 Kilometer von Narva entfernt an der Mündung des Flusses in die Ostsee gelegen. »Dort traf sich im Sommer die sowjetische Kulturelite, Musiker, Schauspieler und Komponisten, aber auch Generäle. Meine Ferien waren russisch geprägt, während ich den Rest des Jahres auf eine estnische Schule ging«, erzählt er. Noch jetzt kann man in Narva-Jõesuu ein paar der großzügig gebauten Sanatorien für das damalige sozialistische Proletariat entdecken und an den breiten Sandstränden Sonne tanken.
Wer zum Meer aufbrechen will, nimmt am besten die »Caroline«, ein kleines Flussschiff, das zweimal täglich von Narva aus fährt. Dass die Narva ein Grenzfluss ist, merkt man höchstens an den gelegentlich auftauchenden Patrouillenbooten. Ansonsten gleitet das Schiff vorbei an Anglern in Ruderbooten, verwittertem Totholz und dichtem Ufergrün – eine stille Idylle im Schatten der Festungen.
Urbanes Leben in Tallinn
Architekturfreunde zieht es eher nach Tallinn. Denn in Narva selbst überstanden nur sehr wenige historische Gebäude den Feuersturm des Zweiten Weltkriegs. Tallinns Altstadt hingegen ist so gut erhalten, dass man sich im mittelalterlichen Stadtzentrum der einstigen Hansestadt fast wie zu Störtebekers Zeiten fühlen kann. Die Bedienung in Traditionslokalen wie »Olde Hanse« kleidet sich zur Freude vieler Touristen sogar in mittelalterlich wirkende Kostüme.
Besondere Attraktion ist aber das Arrangement aus Holzbänken, Grünpflanzen und Bäumen, das im Rahmen des European Green Capital Programs 2023 auf dem einst als »steinerne Wüste« verschrienen Rathausplatz in der Altstadt errichtet wurde. Junge und Alte, Einwohner und Touristen versammeln sich dort, genießen die Sonnenstrahlen, packen ihr Picknick aus oder halten ein kleines Nickerchen.
Tallinn ist reich an Museen. Das Spektrum reicht vom einst für die Zaren errichteten Schloss Katharinental über das postmoderne Kunstmuseum Kumu und das opulente Schiffahrtsmuseum am Wasserflugzeughafen – mit dem Skelett eines Wikingerschiffs und dem ersten U-Boot der estnischen Marine – bis hin zu Spezialmuseen wie dem zu internationalen Ritterorden und gleich zwei KGB-Museen.
Naturliebhaber kommen in Estlands sechs Nationalparks auf ihre Kosten. Besonders reizvoll ist der Vilsandi-Nationalpark im Westen der Insel Saaremaa: Über 150 kleine Inseln, ein Paradies für Robben, Seevögel und seltene Orchideen. Wer lieber große Tiere erleben möchte, reist in den Alutaguse-Park, zwei Stunden von Tallinn, eine Stunde von Narva entfernt. Dort verbringt man die Nacht in rustikalen Holzhütten, still und mit eigener Verpflegung – raschelnde Verpackungen unerwünscht. Während draußen Bären angelockt werden, sitzen die Menschen geschützt hinter Brettern. Mit Glück zeigen sich auch Dachse, Rehe, Fledermäuse und seltene Vögel. Ein Stück Wildnis, das die Nähe Europas zum Norden spürbar macht.
- Anreise: Von Berlin aus Direktflüge nach Tallinn mit Air Baltic (www.airbaltic.com) und Ryanair (www.ryanair.com).
- Transport: In Tallinn kostenloser ÖPNV für Einwohnerinnen, für Gäste günstige Tickets. Zwischen Städten Züge mit Elron (www.elron.ee), Fernbusse mit Lux Express (www.luxexpress.eu).
- Narva: Grenzstadt mit Hermannsfeste und stillgelegter Kreenholm-Fabrik, Infos bei Visit Narva (www.visitnarva.ee).
- Tallinn: Unesco-geschützte Altstadt, Schloss Katharinental, Museen von Kumu bis KGB, Tipps bei Visit Tallinn (https://www.visittallinn.ee).
- Natur: Nationalparks wie Vilsandi mit Robben und Orchideen oder Alutaguse mit Bärenbeobachtung, Infos bei Estonian Nature Parks (www.rmk.ee/en/).
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.







