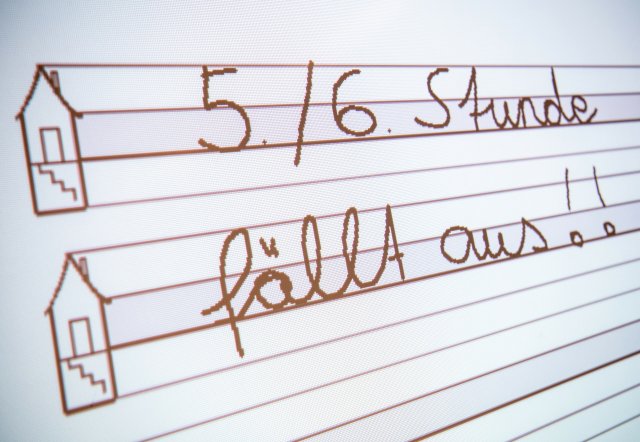- Politik
- Intelligente Kameras
KI-Überwachung entert öffentlichen Raum
Hessen führt Echtzeit-Gesichtserkennung ein, Hamburg weitet Verhaltenserkennung auf Nahverkehr aus

Ende August hat Hessens Innenminister Roman Poseck eine neue KI-gestützte Überwachungsmethode vorgestellt: Im Frankfurter Bahnhofsviertel darf die Polizei seit dem 10. Juli Kameras mit Gesichts- sowie Verhaltenserkennung einsetzen. Nach Pilotprojekten aus den letzten 17 Jahren ist dies die erste Echtzeit-Anwendung der Technik im öffentlichen Raum – zunächst aber im »Probe-Wirkbetrieb«. Das System basiert auf Anwendungen zu Künstlicher Intelligenz (KI).
Vor fast 20 Jahren hatte das Bundeskriminalamt erstmals Gesichtserkennung am Bahnhof in Mainz erprobt, ein Jahrzehnt später folgten ähnliche Tests mit Systemen verschiedener Anbieter am Berliner Bahnhof Südkreuz – damals noch mit freiwilligen Proband*innen. In Frankfurt trifft dies nun alle Passant*innen: »Mit der KI-gestützten Videoüberwachung schlagen wir ein neues Kapitel für die Sicherheit in Hessen auf«, teilte Poseck mit. Dazu hat Hessen als Erstes Bundesland einen Paragrafen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Auswertung von Videoüberwachung in das Polizeigesetz aufgenommen.
Terrorverdächtige und Vermisste im Fokus
Von polizeilichem Interesse sind Verdächtige oder bekannte Straftäter*innen im Bereich Terrorismus, aber auch Vermisste sowie Opfer von Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung. Ihre Bilder dürfen aber nur zum Abgleich mit den Echtzeit-Daten aus der Videoüberwachung genutzt werden, wenn dafür richterliche Beschlüsse vorliegen.
»KI-gestützte Systeme können große Datenmengen schneller auswerten und so die Polizei dabei unterstützen, gesuchte Personen schneller aufzuspüren«, begründet der Innenminister den Einsatz. Gerade in der Umgebung des Frankfurter Verkehrsknotenpunkts sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass vermisste Kinder und Jugendliche dort auftauchen und durch die KI-Videoanalyse erkannt werden. In der nächsten Phase soll die Erkennung von Waffen, Messern und gefährlichen Gegenständen im Fokus stehen – diese Technik soll Ende des Jahres erstmals zum Einsatz kommen.
An der Einführung der neuen Überwachungstechnik gibt es auch Kritik. Der Verein Doña Carmen beschwerte sich im Juni beim Hessischen Datenschutzbeauftragten, da auch ihre Beratungsstelle für Sexarbeiter*innen im Bahnhofsviertel davon erfasst wird. Das linke Hausprojekt NiKa klagte im Juli gegen das Land Hessen wegen der KI-gestützten Kameraüberwachung ihrer Haustür. Die massiven Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte aller Menschen lösten die Probleme im Bahnhofsviertel nicht, sondern verschärften diese, heißt es in einer Mitteilung.
Öffentlicher Raum wird Überwachungslabor
Eine KI-Überwachung des öffentlichen Raums gibt es bereits in Hamburg. Dort setzt die Polizei am Hansaplatz und Hachmannplatz vor dem Hauptbahnhof auf Verhaltenserkennung. Das System soll mithilfe von insgesamt 29 Kameras des umstrittenen chinesischen Herstellers Hikvision Gewalttaten erkennen und beispielsweise Faustschläge von gewöhnlichen Armbewegungen unterscheiden können. Eine Ausweitung auf Gesichtserkennung ist technisch möglich, jedoch ist diese Funktion laut dem Hamburger Senat »derzeit deaktiviert«.
Die Aufnahmen von Passant*innen sollen nun zum Training der KI verwendet – und dürfen dazu bis zu einem Jahr gespeichert werden. Zuständig dafür ist ein Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Das stößt in Hamburg auf scharfe Kritik. Die örtliche Linksfraktion sieht die Ausweitung als »Teil einer gezielten Verschärfung von Polizeigesetzen und Befugnissen«. Der öffentliche Raum werde zum Testlabor für Überwachung, dabei würden besonders Jugendliche, Wohnungslose, Drogengebrauchende, Sexarbeiter*innen und People of Color diskriminiert.
Drei Wissenschaftler*innen der Universität Hamburg und der TU Chemnitz begleiten das Hamburger Projekt kritisch. Sie bestätigen die Kritik der Linksfraktion: »Menschen werden ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung zu Versuchspersonen eines Experiments gemacht«, sagt die Hamburger Forscherin Stephanie Schmidt. Zudem führe die Technologie zu ihrer eigenen Ausweitung: »Die Notwendigkeit, neue Trainingsdaten zu generieren, hat den Effekt, dass man immer auf der Suche nach Möglichkeiten ist, diese KI einzusetzen«, so Forscher Philipp Knopp.
Wer nicht überwacht werden will, muss fernbleiben
Wer nicht möchte, dass seine Aufnahmen zum KI-Training verwendet werden, muss die Plätze zu den Aufnahmezeiten meiden. Auch der Hamburgische Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs hatte deshalb Fragen zur Speicherdauer und zum Zugriff auf die Bilder gestellt, von der Polizei aber zunächst keine Antworten erhalten.
Die Ausweitung der KI-Überwachung auf den Nahverkehr ist bereits geplant. Die Hamburger Hochbahn hat ein Pilotprojekt zur »automatischen Mustererkennung mittels KI« an U-Bahn-Haltestellen angekündigt. Die Technik soll Mitarbeitenden in der Leitstelle automatisch Hinweise auf »potenziell sicherheitskritische Vorfälle« geben. Als gefährliche Verhaltensweisen gelten etwa der Aufenthalt einer Person oder einem Gegenstand im Gleisbereich, tätliche Auseinandersetzungen oder Vandalismus sowie ein »ungewöhnlich langer Aufenthalt am Bahnsteig«.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.