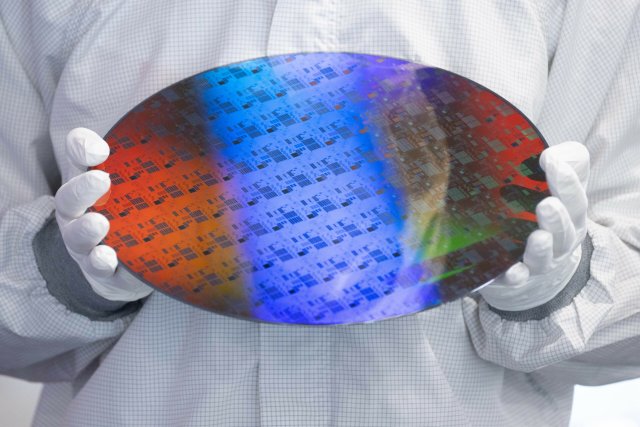- Wirtschaft und Umwelt
- Wärmewende
Stadtwerke fordern »Winter der Entscheidungen«
Kommunale Unternehmen setzen beim künftigen Heizen kaum auf grüne Gase

Mitunter kommt es nicht anders als erwartet. Im Vorfeld des jährlichen Stadtwerkekongresses, der in dieser Woche in Mainz stattfand, hatte der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) rund 600 Stadtwerke und kommunale Energieversorger zur Wärmewende befragt. Etwas mehr als 160 der angeschriebenen Unternehmen antworteten. Unter anderem wurde gefragt, welche Wärmetechnologie in ihrem Gebiet künftig die zentrale Rolle spielen wird. Ergebnis: Fast jedes zweite Unternehmen plant für die Zukunft mit einer Heizmischung aus Fernwärme und Wärmepumpen. Auf Platz zwei folgt mit 38 Prozent die Kombination Strom/Wärmepumpen sowie auf Rang drei die Fernwärme allein mit 23 Prozent. 10 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, bei ihrer Wärmeplanung sei aktuell noch alles offen.
Grüne Gase wie Wasserstoff oder Biomethan spielten bei den Antworten nur eine Nebenrolle – je nach Kombination lag ihr Anteil bei 4 oder 8 Prozent. Die in der Öffentlichkeit stets stark präsenten Verfechter der Idee, von Erdgas könne man künftig einfach auf Wasserstoff zum Heizen umsteigen, dürften von den Umfragedaten wenig begeistert sein.
Derzeit werden noch drei Viertel aller Wohnungen in Deutschland mit Gas oder Öl beheizt und weitere 15 Prozent mit Fernwärme, für die teilweise sogar noch Kohle eingesetzt wird. Erneuerbare Energien haben beim Heizen im Bestand nur einen geringen Anteil. Allerdings dominieren Wärmepumpen im Neubau.
Dass künftig der Fokus auf einem Mix von Fernwärme und Wärmepumpen liegen wird, kommt auch für VKU-Chef Ingbert Liebing nicht ganz überraschend, wie er vor dem Kongress bei einem Medientermin erklärte. Auch für ihn spielen grüne Gase, ob Biomethan oder Wasserstoff, künftig nur eine untergeordnete Rolle.
Der Schleier über der Zukunft des Heizens lüftet sich dabei schnell. Denn rund 90 Prozent der Versorger gehen in der Umfrage davon aus, dass der Wärmeplan ihrer Kommune fristgemäß Mitte 2026 (für Großstädte) oder Mitte 2028 (für alle anderen Städte) fertig sein wird. Die übergroße Zahl der Stadtwerke sorgt sich insbesondere um die Kosten der Wärmewende für Wirtschaft und Bürger, ergab die Umfrage weiter. Zwei Drittel der Versorger halten die derzeitige Finanzierung für unzureichend, und für etwas mehr als die Hälfte ist die Rechtslage unklar.
Daraus könne eine mangelnde Akzeptanz der Wärmewende in der Bevölkerung resultieren, warnte CDU-Politiker Liebing. Die Regierungskoalition solle deswegen die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze von derzeit jährlich gut einer Milliarde Euro auf 3,5 Milliarden Euro dauerhaft aufstocken. Wichtig seien auch weniger Bürokratie sowie schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben.
Mehr rechtliche Klarheit wünschen sich die Stadtwerke vor allem bei der von der Koalition geplanten Abschaffung des Heizungsgesetzes sowie bei der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes nach europäischen Vorgaben. Im Moment sei nicht klar, wie das geschehen soll, betonte der VKU-Chef. Angesichts der laufenden Wärmeplanung in vielen Kommunen werde hier schnell Klarheit gebraucht. Entsprechend müsse das Bundeswirtschaftsministerium im Herbst Entwürfe für wichtige Gesetzesvorhaben wie das Gebäudeenergiegesetz oder das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz vorlegen. Auch müssten das Wärmeplanungsgesetz, die Wärmelieferverordnung und die Fernwärmeverordnung überarbeitet werden. Ein »Winter der Entscheidungen« für die Wärme müsse das Ziel sein.
Neben der Wärmewende beschäftigt die Stadtwerke auch der vom Wirtschaftsministerium Mitte September vorgelegte Monitoringbericht zur Energiewende. Darin finde sich weder eine Absage an die Energiewende, noch begründe der Bericht ein Rollback in ein fossiles Zeitalter, stellte Liebing klar. Er plädierte für einen ganzheitlichen Blick auf die Energiewende. Für den VKU müsse der Ausbau der Erneuerbaren stärker mit Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Kosteneffizienz in Einklang gebracht werden.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Er wies in dem Zusammenhang Kritik zurück, die kommunalen Versorger seien nicht an Klimaschutz interessiert. Für die Stadtwerke sei es selbstverständlich, dass sie das Klimaneutralitätsziel akzeptierten und erreichen wollten, erklärte er auf Nachfrage. Damit werde auch die Nutzung von Gas perspektivisch auslaufen. In der Vergangenheit sei dieses Geschäft sicherlich ein ertragskräftiger Gewinnbringer der Stadtwerke gewesen, und das sei auch zurzeit noch so, räumte der VKU-Chef ein. Die Energiewende stelle aber alle vor die Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle umzustellen, ob das nun den Strom oder die Wärme betreffe. »Wir haben überhaupt kein Interesse daran, künstlich den Verbrauch von Gas zu verlängern, nur aus geschäftlichen Interessen heraus.«
Aus dem Monitoringbericht des Wirtschaftsministeriums liest der kommunale Spitzenverband allerdings auch keinen schnellen Abschied vom Erdgas heraus. Beim weiteren Ausbau der Erneuerbaren steuere Deutschland auf eine »Versorgungslücke« zu, sofern es nicht gelinge, gesicherte Kapazitäten zu schaffen, betonte der VKU-Chef. Für diese Energiesicherheit sieht er zwei Möglichkeiten: neue Gaskraftwerke, die in der Perspektive klimaneutral umgerüstet werden, und einen Kapazitätsmarkt für flexible Erzeugung. Für diesen werbe der Verband, man halte aber auch schnelle Ausschreibungen für Kraftwerke mit gesicherter Leistung für nötig, die eben zunächst Gaskraftwerke sein würden, führte Liebing entsprechend aus. Der VKU nenne diese Anlagen im Übrigen »Transformationskraftwerke«.
Die kommunalen Versorger haben sich für ihre neuen fossilen Kraftwerke also ein transformatives Etikett einfallen lassen. Das war auch nicht anders zu erwarten.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.