- Wirtschaft und Umwelt
- Digitalisierung
Elektronische Patientenakte: Fehlstart statt Fortschritt
Die elektronische Patientenakte (ePA) wird verpflichtend, Sanktionen kommen aber erst später

Widersprüchlicher könnten die Aussagen zur Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) nicht sein: Die einen loben deren künftigen Nutzen in den Himmel, die anderen bezweifeln, dass das Projekt überhaupt schon im Stadium eines absehbaren Nutzens ist.
Die elektronische Patientenakte wird allen gesetzlich Versicherten von ihrer Krankenkasse zur Verfügung gestellt. Ab diesem 1. Oktober sind Ärzte verpflichtet, Befunde, Röntgenbilder, Impfnachweise oder Medikationspläne in der ePA zu speichern. Im besten Falle können so Doppeluntersuchungen vermieden werden. Aufwendige Kommunikation zwischen verschiedenen Ärzten oder mit Apotheken ließe sich reduzieren. Zum genannten Stichtag sind auch alle Krankenhäuser und Apotheken verpflichtet, die ePA zu nutzen.
Eine unvollständige Akte könnte medizinische Fehlentscheidungen zur Folge haben.
Auch wenn die Nutzung kostenlos und freiwillig ist, fühlt sich laut AOK mehr als die Hälfte der Versicherten nur unzureichend informiert. Zwar verfügen über 70 Millionen Versicherte (theoretisch) schon über eine ePA, aber nur etwa drei Millionen von ihnen über die Gesundheits-ID, mit der sie auf die App zugreifen können.
Was braucht der Versicherte? Auf jeden Fall ein Smartphone, mit relativ neuem Betriebssystem, mindestens iOS 15 (2021 erschienen) für eine iPhone. Für Geräte mit Android sollte Version 10 (2019 erschienen) ausreichen. Dennoch, was tun diejenigen, die sich nie auf ein Smartphone einlassen wollten oder konnten? Alternativ ist eine Desktop-Version im Angebot – oder nur eine passive Nutzung, bei der behandelnde Ärzte die Akte verwalten, der Versicherte selbst aber keinen Zugriff auf die Daten hat.
Die erste Crux bei der eigenständigen Nutzung dürfte die Freischaltung sein, für die es vier mehr oder weniger aufwendige Varianten gibt, darunter mit der Gesundheits-ID der Krankenkasse oder mit eID-Funktion des Personalausweises, die aber auch nur von 22 Prozent der Bevölkerung genutzt wird. Schon seit Mitte 2025 können ePA-Daten ohne die Einwilligung von Nutzern pseudonymisiert an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit übertragen werden – hier gibt es jedoch ein Widerspruchsrecht.
Das Lob für eine geglückte ePA-Einführung konzentriert sich auf den Nutzen für die Patienten, und zwar einerseits im Notfall, andererseits bei den Möglichkeiten, die eigenen Gesundheitsdaten jederzeit einzusehen und selbst zu entscheiden, welche Akteure des Gesundheitswesens das ebenfalls dürfen – oder eben nicht. Wer hier etwas einschränken will, braucht jedoch viel Geduld. Und Teile der Medikationsliste können nicht einzeln gesperrt werden. Wer nicht will, dass E-Rezept-Daten automatisch in die Medikationsliste übertragen werden, kann ebenfalls widersprechen. Allerdings geht dann der Schutz vor Arzneimittelwechselwirkungen verloren. Nutzerfreundlichkeit sieht anders aus.
Aber schon die Entscheidung von Patienten, die eine oder andere Diagnose oder bestimmte Befunde sollte dieser oder jener Arzt nicht einsehen, führt zu einer unvollständigen Akte. Das könnte medizinische Fehlentscheidungen zur Folge haben. Außerdem können Patienten prinzipiell ablehnen, dass bestimmte Dokumente überhaupt in die Akte gelangen. Auch aus diesem Grund dürfte es mit der Vision eines der größten medizinischen Datensätze weltweit, von der Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach schwärmte, in der Praxis erst einmal nicht weit her sein.
De facto existieren immer noch einige Sicherheitslücken, auch technische Schwierigkeiten sind teils unbewältigt. Dazu gehört, dass erst 80 Prozent der Arztpraxen mit dem nötigen Softwaremodul ausgestattet sind. Darüber informierte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in dieser Woche. Die vorhandenen Praxisverwaltungssysteme müssen mit dem Modul ergänzt werden, in einem Teil der Fälle soll das in diesem Quartal erfolgen, andere Hersteller hätten auf entsprechende Anfragen nicht reagiert.
In den Krankenhäusern genügt ein einfaches Update nicht. Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft gingen im September von 382 Kliniken 58 Prozent davon aus, dass die ePA erst im Laufe des nächsten Jahres in ihren Häusern vollständig einsetzbar sei.
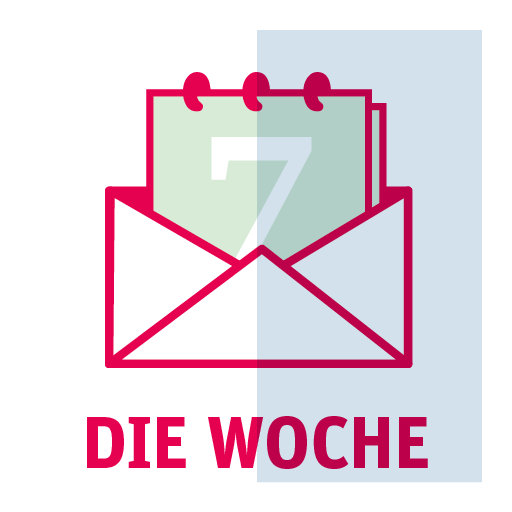
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Der Zugriff der Apotheken auf die Medikationsliste der ePA wird ebenfalls von den Versicherten etwa durch Stecken ihrer Karte in ein Lesegerät gewährt. Dann hat die Apotheke für drei Tage Zugriff auf die Liste, in der alle per E-Rezept verordneten und tatsächlich abgegebenen Medikamente stehen. So sollen Wechselwirkungen festgestellt und Doppelverordnungen bereinigt werden können. Bislang war das insbesondere bei chronisch Kranken und anderen Patienten mit vielen verschiedenen Medikamenten ein sehr hoher Aufwand.
Angesichts dieser Schwierigkeiten erscheint es realistisch, dass finanzielle Sanktionen erst ab Anfang 2026 vorgesehen sind. So könnte den Arztpraxen die Pauschale für die Telematikinfrastruktur gekürzt werden, oder gar das Gesamthonorar zum Beispiel um ein Prozent. Bei anhaltender Verweigerung des ePA-Einsatzes könnten Praxen komplett von der Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen werden.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







