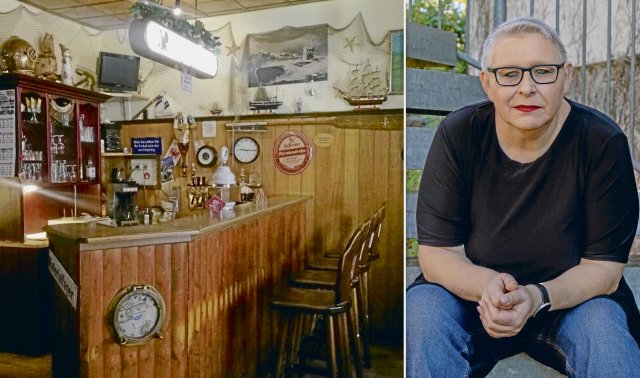- Berlin
- Antisemitismus
Vor den Nazis aus Potsdam nach Palästina geflohen
Lebenszeugnisse des jüdischen Rechtsanwalts und SPD-Stadtverordneten Ludwig Levy

»Was mir im Juli 1933 angetan wurde – die bedachte Vernichtung meiner Berufstätigkeit und meines Berufes überhaupt – brachte mir den Tod«, schrieb der Rechtsanwalt Ludwig Levy zehn Jahre später im Exil in Palästina. Er war nur noch eine lebende Leiche.
Noch einmal 80 Jahre später haben Sabine Hering und Johannes Leicht die 186 handgeschriebenen Seiten in Druck gegeben und dabei mit umfangreichen biografischen Angaben und Erläuterungen ergänzt. Dies haben sie im Auftrag der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße und mit Förderung der Stadt Potsdam und der brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung getan.
Ludwig Levy stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Seine Vorfahren lebten wohl spätestens seit den 1840er Jahren in Potsdam. Doch der 1883 geborene Ludwig Levy war nicht religös und fühlte sich ganz und gar als Deutscher. Er kämpfte wie sein damals gefallener Bruder Adolf als Soldat im Ersten Weltkrieg, war Offizier und wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Er war außerdem bereits vor 1914 als Rechtsanwalt zugelassen – zwei Gründe, die normalerweise selbst nach den diskriminierenden Bestimmungen der Nazizeit genügt hätten, ihm 1933 vorerst seine Zulassung als Rechtsanwalt noch nicht zu entziehen.
Doch Levy, der von 1929 bis 1933 SPD-Stadtverordneter war, wurde zum Vorwurf gemacht, er habe als Rechtsanwalt Kommunisten verteidigt. Darauf konnte sich der so Beschuldigte kaum besinnen. Vielleicht waren unter aufrührerischen Arbeitern der Ziegeleien in Glindow, die er vertreten hatte, tatsächlich zwei Kommunisten? Aber wenn schon: Jeder Angeklagte hat das Recht auf einen Anwalt, und Levy hatte unbesehen etliche NSDAP-Mitglieder vor Gericht vertreten.
»Ich lebe für das Recht«, war seine Überzeugung. So heißt auch das Buch. Levy hatte vorher nicht geahnt, wie Recht von den Nazis gebeugt und gebrochen wird, wenn sie an der Macht sind. Die Faschisten steckten ihn 1933 ins KZ Oranienburg und 1938 ins KZ Sachsenhausen. Dann war ihm klar, dass er seine Heimat verlassen muss, um sein Leben zu retten. In höchster Not wanderte Levy nach Palästina aus. In der Nacht zum 26. Dezember 1938 ließ er die deutsche Grenze hinter sich und atmete trotz aller Sorgen befreit auf. Sein Vermögen verlor er, musste fortan in bescheidenen Verhältnissen leben. Ein Neuanfang mit 55 Jahren fiel dem Mann schwer, der fast kein Hebräisch sprach und nur schlecht Englisch. Immerhin konnte er seine Segeljacht nach Haifa ausführen und vermietete sie dort an die britische Küstenwache, die damit andere jüdische Flüchtlinge von Palästina fernhielt. Später verdingte sich Levy dem britischen Militär als ziviler Verwalter.
Seine erwachsene Tochter Marianne, die schon länger in Palästina lebte, heiratete den libanesischen Arzt Farid Teen. Diese Verbindung stieß bei den Eltern beider Partner zunächst auf Vorbehalte. Doch sie überzeugten sich, dass Marianne und Farid anständige Menschen waren, und schlossen sie ins Herz. Ende Oktober 1946 übersiedelten Ludwig Levy und seine Frau Antoine gemeinsam mit Tochter Marianne, Schwiegersohn Farid und Enkeltochter Monika nach Australien, wohin die zweite Tochter Irene mit ihrem Mann Erich Lehmann und ihrem Kind geflüchtet war. Erich Lehmann hatte in Potsdam eine Konservenfabrik gehört, in der er auch seinen Schwiegervater beschäftigte, nachdem dieser als Rechtsanwalt nicht mehr hatte arbeiten dürfen. Diese Fabrik wurde »arisiert«. Erich Lehmann musste sie für einen Bruchteil ihres Wertes abtreten.
Ab den 1950er Jahren erhielt Levy bis zu seinem Tod 1966 von der Bundesrepublik eine Opferrente von 600 D-Mark monatlich. Die Summe wurde erst im Jahr seines Todes auf 1000 D-Mark erhöht. Für insgesamt 56 Tage Haft im Potsdamer Polizeigefängnis sowie in den Konzentrationslagern Oranienburg und Sachsenhausen wurde Levy einmalig mit 150 D-Mark mehr schlecht als recht entschädigt.
Seit 2013 erinnert am Saal der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung eine Tafel an Ludwig Levy. Bei der Kommunalwahl im März 1933 war Levy erneut in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden, hatte angesichts des damals herrschenden Naziterrors sein Mandat aber nicht mehr angenommen. Alle Mandate seiner ebenfalls gewählten Genossen erkannten die Nazis bald darauf ab und verboten die SPD.
Die Gedenktafel vermerkt, dass Levy stellvertretender Vorsitzender des Stadtparlaments gewesen ist und im Finanzausschuss mitgewirkt hat. Dort steht auch, dass Levy ab 1956 andere Verfolgte des Naziregimes bei der Durchsetzung ihrer Entschädigungsforderungen juristisch beraten hat. Der Text der Gedenktafel endet mit dem Versprechen: »Wir werden sein Andenken ehren.«
Sabine Hering/Johannes Leicht: Ich lebe für das Recht. Der Potsdamer Jurist Ludwig Levy (1883–1966), herausgegeben im Auftrag der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße, 142 Seiten, geb.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.