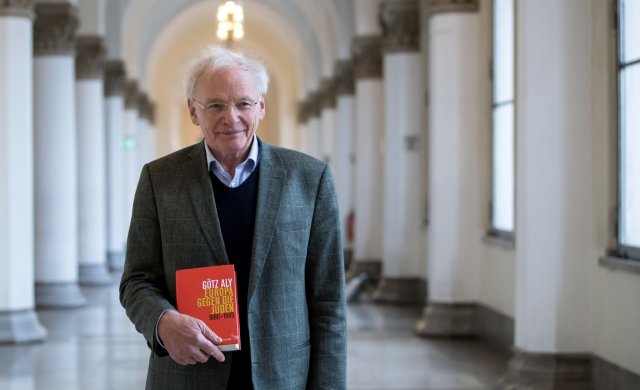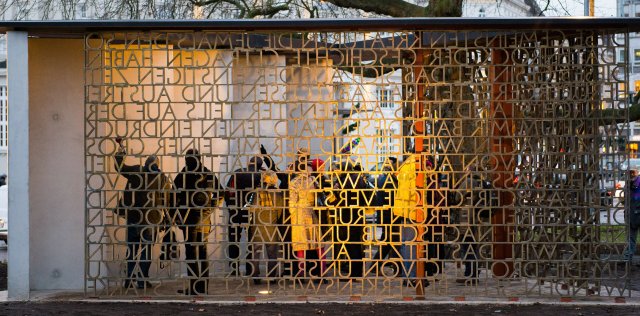- Kultur
- Frankfurter Buchmesse
Internet-Existenz: Metastasen mit Todesantrieb
Richard Schuberths Roman »Der Paketzusteller« über das Narrenreservat Facebook

In einem Neuland vor unserer Zeit: In der zweiten Hälfte der 2010er Jahre schien das Internetchaos noch ein sortiertes. Die Corona-Pandemie und ihre Verwerfungen hatten die Außenwelt und ihre Protagonisten noch nicht verunmöglicht. Nebst Fotodreck auf Instagram und der rückfeuernden Waffe der chinesischen Genossen zur geistigen Wehrkraftzersetzung des Westens, dem 2016 gelaunchten Tanzflugkörper Tiktok, gab es noch ein paar Aufrechte, die über Facebook den Internettümpel mit manchmal geraden Sätzen salzten.
Eine von ihnen ist Gerhild Pfister, Wienerin, Ende 40, die es mit ihrem Kunst-Dies-Das nicht weit gebracht hat. Fortgeschritten sind dagegen die Krebsmetastasen in ihren Nieren. Was die joblose Vollzeitironikerin und Zweieinhalbte-Welle-Feministin mit integriertem Antisemitismusdetektor nicht gerade dazu bringt, sich in den Kommentargefechten zurückzuhalten: »Wann wickelt ihr Wachspapiernazis euch endlich selber ein und rollt Richtung Biotonne?« So neckt die Hauptfigur dauerfeuernd im nicht nach ihr benannten Roman »Der Paketzusteller« von Richard Schuberth.
Jener Postbote, Haydar, Lakai eines polnischen Amazon-Subunternehmers, darf erst spät und auf Einladung Gerhilds zur Fellatio in die Handlung einsteigen. Die dauerhaft von LSD und Pilzen berauschte Todeskandidatin ist im Real Life nicht weit weg von ihrem distinktiv-krawallsüchtigen Onlineauftritt. Ob Haydar also von seinem zwielichtigen Chef wegen Betriebsruhestörung um die Ecke gebracht wird oder ob der Sohn aus dem Iran geflohener Kommunisten (»Er hat wirklich jeden Test bestanden. Er zeigt kaum frauenfeindliche Tendenzen, hasst den Islam und eigentlich jede Religion, ist erfrischend apolitisch, pinkelt im Sitzen, und sein Antisemitismus übersteigt nicht den durchschnittlichen Pegel, dümpelt sogar weit darunter vor sich hin.«) vor der Polemikerin flieht, ist entsprechend unklar.
Auch Gerhild schafft für eine Weile den Absprung aus der großteils anonymisierten und arg unverbindlichen Labersphäre, schließt das Facebook-Tab und schreibt mit letzter Hand erst eine Sozialreportage über migrantische Amazon-Knechte in Wien und anschließend über den hiesigen Islamismus, um die Texte allerlei Medien feilzubieten, für deren Erzeugnisse noch Freund Baum gefällt wird. Manches will man dann doch auf Papier gepresst haben – was wären Printmedien ohne die Seite für Todesanzeigen?
Unter den sogenannten sozialen Medien schweigen die Musen: Gerhilds Opponenten sind im doppelten Sinne simuliert. Ihre Statements und Erwiderungen sind Steilvorlagen, die – selbst wenn solche die WWW-Postfächer und -Meinungsmärkte wirklich verstopfen – mitunter von Schuberth recht preiswert herbeigezaubert sind.
Ein Lotterleninist namens Bodgan Uljanow etwa schimpft auf Ziehkoffer (»Ich hasse Trolleys, weil ich sie mit Managern und Yuppies assoziiere«), und aus einer Redaktion, die aus ihrem Selbstverständnis heraus ein »metalinkes Diskursmedium« verantwortet, bekommt sie eine Abfuhr auf ihr Textangebot mit dem Hinweis: »Selbst ein liberaler, zu Unrecht als Linker gelesener Typ wie Präsident Van der Bellen hat die Gefahr der Islamophobie erkannt und Österreichs Frauen zur Solidarität mit Muslimas durch Anlegen eines Kopftuchs aufgefordert.«
Gleich groß wie die Realität: Eine »hundsgemeine Gesellschaftssatire«, wie der Verlag den Roman bewirbt, ein entlarvender Zoom auf passierenden Unfug ist »Der Paketzusteller« eben genau nicht. Durch die Romanhaut hindurch schimmert das fragmentarische Essay, mit dem Gerhild selbst widerlegt, dass hier alles so mickrig zugeht, wie es nun wirklich zugeht: »Social Media mag ein Narrenreservat sein, aber leider gibt es außerhalb davon keine Reservate der Weisheit mehr.« Die mit ideologiekritischen Flach- und kulturalistischen Strohmännern geführten Dialoge entsprechen zu sehr dem Zustand der Linken im deutschsprachigen Raum, der dramaturgisch metastasierende Plot zu sehr dem Status quo der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Richard Schuberths großes Verdienst ist dabei nicht nur sein gewandter Sprachgebrauch und die liebevolle Bearbeitung noch der randständigsten Stoffe (etwa der Erotik im fortgeschrittenen Alter), sondern vor allem das Festhalten ebenjener hässlichen Zustände: Eine Linke mit selbst gebautem Todesantrieb macht bei der applizierten Trolldemokratie mit, nur um es am besten wissen zu dürfen und den Simulationssermon auch noch als Anzeiger dafür auszuschildern, dass es so schlimm doch gar nicht sei. In der Scheiße, in der man steckt, darf man noch öffentlich schimpfen; das dämpft den Unmut darüber, dass man nichts dran ändern kann.
Trübe Aussichten, die man gar nicht aufgehellter will. Kritische Kritiker werden in bequemer Denkerpose sagen, es sei Fake, wenn man sich in die Lage versetzt, etwas zu ändern. Aber Reservate der Weisheit, die sind außerhalb der Internet-Spielplätze für Schmöcke machbar. We used to be a party, a proper party.
Richard Schuberth: Der Paketzusteller. Drava-Verlag, 340 S., geb., 24 €.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.