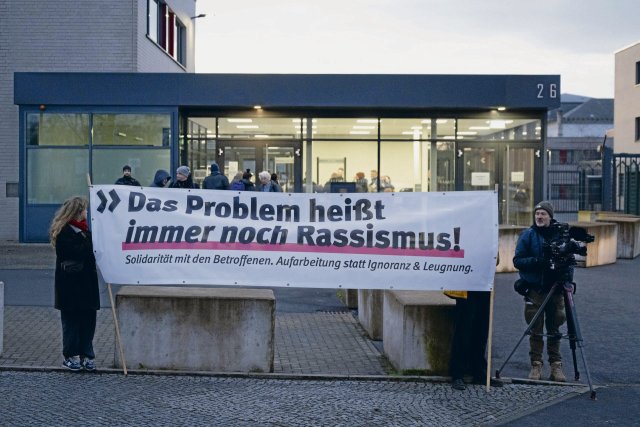- Politik
- Uganda
Frauen in Afrika: »Mein Esel heißt Happy, weil ich glücklich bin«
Wo das Gesetz längst Gleichheit kennt, halten Traditionen die Zeit an. In Uganda sind es Frauen, die diesen Stillstand langsam brechen

Er fragt mich: Wer sind deine Leute? Wer ist dein Vater, dein Großvater? Ich antworte mit den Namen meiner Mutter, dem ihrer Mutter und meiner Urgroßmütter. Ich nenne die Namen der Landstücke, die sie nicht erben konnten – außer wenn ein Bruder, Vater oder Ehemann es erlaubte. Ich summe die Namen der Frauen wie ein vergessenes Gebet, ein verbotenes Lied. Und als er mich wieder nach meinen Vorfahren fragt, frage ich zurück: Und wer hat sie geboren?» Mit diesen Worten schildert die ugandische Dichterin Arao Amenys in «Home is a Woman» die Situation vieler Frauen in Uganda. Rubinah Rubimbwa hat am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet zu fliehen. Sie kam einst ohne Hab und Gut mit ihren Kindern an der Hand nach Uganda. Vielleicht ist sie deshalb so überzeugt vom Wandel, der von unten kommt. «Ich glaube an Lösungen, die in den Gemeinden selbst entstehen», sagt sie.
Rubimbwa, Aktivistin und Friedensvermittlerin, kämpft seit Jahren dafür, dass Frauen im ostafrikanischen Uganda selbst über ihr Leben bestimmen können. Etwas bewegt sich in Uganda. Frauen werden sichtbar, sie widersprechen und übernehmen Verantwortung nach Jahrhunderten der Unsichtbarkeit. Auf dem Papier gilt Gleichstellung längst als erreicht. Doch Wandel entsteht erst dort, wo Frauen selbst handeln, leise, entschlossen und oft gegen den Strom. Die Verfassung Ugandas von 1995 gilt als eine der progressivsten Afrikas. Sie entstand in einer Zeit des politischen Aufbruchs und formulierte Gleichberechtigung, die in der Region damals ihresgleichen suchte. Artikel 21 garantiert die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und verbietet Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Artikel 32 verpflichtet den Staat zu positiven Maßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen und erkennt an, dass Ungleichheit nicht nur rechtlich, sondern auch kulturell entsteht. Absatz 2 verbietet ausdrücklich Gesetze, Bräuche und Traditionen, die der Würde oder den Interessen von Frauen schaden.
Die Verfassung Ugandas verspricht viel. Sie schützt Frauen, Menschen mit Behinderungen und andere benachteiligte Gruppen. Doch in der Realität bleiben viele Rechte Theorie. Patriarchale Strukturen, Armut und der Mangel an Ressourcen prägen das Leben weit stärker als die Buchstaben des Gesetzes. Wirkung zeigt, was von unten wächst: Frauen, die eigene Geschäfte aufbauen, politische Verantwortung übernehmen oder sich in ihren Gemeinden engagieren, gewinnen an Selbstvertrauen und verändern damit mehr, als es Paragrafen vermögen.
In Uganda ist Land weit mehr als Besitz – es ist Lebensgrundlage, Status und Macht. Doch was auf dem Papier gleichberechtigt scheint, bleibt in der Realität für viele Frauen unerreichbar. Zwar garantiert die Verfassung Männern und Frauen dieselben Rechte, doch zwischen Gesetz und gelebter Praxis klafft eine tiefe Lücke. Laut der International Land Coalition (ILC) wächst diese Ungleichheit sogar weiter: Land und Einfluss konzentrieren sich zunehmend in den Händen weniger Männer.
Nur etwa ein Fünftel des ugandischen Bodens ist überhaupt offiziell registriert. Rund 26 Prozent dieser Flächen sind auf Frauen eingetragen – mehr als noch 1999, doch insgesamt sind das gerade einmal fünf Prozent des gesamten Territoriums. Besonders auf dem Land zeigt sich, wie weit Tradition und Gesetz auseinanderliegen. Selbst wer eine Besitzurkunde hat, riskiert alles zu verlieren – etwa nach einer Trennung oder dem Tod des Mannes.
Zu diesen Ungleichheiten kommen alte Muster hinzu. Praktiken wie weibliche Genitalverstümmelung sind zwar seltener geworden, doch in Norduganda sind laut Schätzungen noch bis zu fünf Prozent der Mädchen und Frauen betroffen. Auch das Erbrecht bleibt eine Grauzone: Nach dem Tod eines Mannes dürfen Frauen vielerorts nicht im Haus bleiben oder mit einem neuen Partner dort leben – kulturelle Normen wiegen schwerer als die Verfassung.
Die Pandemie hat diese Ungleichheiten noch verschärft. Als die Schulen schlossen, verloren viele Mädchen nicht nur den Zugang zum Unterricht, sondern auch zu lebenswichtigen Informationen – etwa zur Sexualaufklärung. Laut Human Rights Watch stieg dadurch das Risiko von Früh- und Zwangsverheiratungen deutlich.
Und mit der wachsenden Digitalisierung zeigte sich eine weitere Hürde: Weltweit haben laut UN-Schätzungen rund 327 Millionen weniger Frauen als Männer Zugang zu Smartphones und Internet – in Afrika beträgt die Lücke rund 34 Prozent. Für viele Frauen in Uganda bedeutete das, von Informationen, Bildungsangeboten und staatlicher Unterstützung abgeschnitten zu sein.
Zwar sitzen heute mehr Frauen als je zuvor in Parlamenten und lokalen Räten – im nationalen Parlament liegt ihr Anteil bei 34,1 Prozent, sogar etwas höher als in Deutschland. Mit Jessica Alupo, einer ehemaligen Angehörigen des Militärs, hat Uganda seit 2021 eine Frau als Vizepräsidentin. Doch wirtschaftlich und sozial bleibt die Mehrheit der Frauen weiterhin benachteiligt: Sie bewirtschaften das Land, ernähren Familien, betreiben kleine Läden – doch selten gehört ihnen, was sie schaffen.
Uganda war 2008 das zweite afrikanische Land nach Liberia, das einen Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Agenda «Women, Peace and Security» verabschiedete. Der Plan zielt auf Prävention von Gewalt, Konfliktlösung, gute Regierungsführung und die Stärkung lokaler Strukturen.
Fragt man Rubimbwa, was Frieden für Frauen in ihrem Land bedeutet, antwortet sie: «Es ist etwas zutiefst Persönliches. Für viele Frauen heißt Frieden, das Haus verlassen und sich frei bewegen zu können, ohne dass ein Mann sie belästigt.» Seit 2008, sagt sie, habe sich einiges geändert: «Frauen äußern sich heute, sie gehen zur Polizei, um häusliche Gewalt anzuprangern.» Diesen Erfolg schreibt die Aktivistin dem lokalen Ansatz der nationalen Frauenagenda zu: Pläne würden zuerst in Alltagssprache, dann in lokale Sprachen übersetzt und direkt in die Gemeinden getragen, damit Frauen verstehen, wie sie sich schützen, Bewusstsein schaffen und von der Regierung Rechenschaft einfordern können.
Rubimbwa beschreibt, wie sich in den vergangenen Jahren vieles verändert hat. Früher sei Korruption in den Polizeistationen weitverbreitet gewesen. Frauen, die nach einer Gewalttat Anzeige erstatten wollten, hätten oft zu hören bekommen, es gebe kein Geld, um beispielsweise das notwendige Formular zu kopieren. «Das Formular A, das für die medizinische Untersuchung nach körperlicher Gewalt nötig ist, wurde damals sogar verkauft, obwohl es eigentlich kostenlos sein sollte», erzählt sie. Heute hingegen bekämen Frauen das Formular umgehend, könnten es im Gesundheitszentrum ausfüllen lassen und den Fall anschließend zur Anzeige bringen. «Das ist jetzt Vergangenheit», sagt Rubimbwa. «Inzwischen funktionieren die Abläufe, Verfahren werden eingeleitet, und die Fälle gehen ihren rechtlichen Weg.»

In 63 friedensbildenden Organisationen, vor allem in ländlichen Regionen, arbeiten Frauen, Männer und Jugendliche zusammen. Rubimbwa nennt das «strukturierte Friedensbildung»: Statt in abstrakten Begriffen zu sprechen, beginne man mit einer einfachen Frage: «Welche Themen rauben euch den Schlaf?» Aus den Antworten entstünden Maßnahmen, die direkt das Leben der Gemeinschaften verbessern.
Um Gewalt in den Gemeinden – besonders gegen Frauen – zu verringern, setzt man auf einen Ansatz, der viel Geduld und Engagement verlangt. Frauen und Männer werden als sogenannte Key Influencers ausgebildet: Sie lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und in ihren Gemeinden zu vermitteln. Anschließend geben sie dieses Wissen weiter, sprechen mit Nachbarinnen und Nachbarn und lokalen Autoritäten. Der Einsatz ist mühsam, doch er zielt darauf, Schritt für Schritt eine Kultur zu fördern, in der Konflikte früh erkannt und ohne Gewalt beigelegt werden.
Traditionen infrage stellen
Das Regierungsgebäude der Bezirksverwaltung von Kasese liegt am Ende einer rotstaubigen Straße, die am besten mit einem Allradfahrzeug zu erreichen ist. Das Areal, das sich im Südwesten Ugandas befindet, wirkt etwas in die Jahre gekommen, riesige Grünflächen und alte Bäume prägen die nähere Umgebung. Im Garten steht Asiimwe Zainab, Lokalpolitikerin, bekleidet mit einem knielangen Rock und farblich abgestimmtem beigen Blazer. Bei leichtem Nieselregen erzählt sie von ihrem Lebensweg: von der jungen Frau, die in Armut aufwuchs, über den Weg zu ihrem Masterabschluss und ihre Unabhängigkeit als freiwillig alleinerziehende Mutter bis hin zu ihrer ersten politischen Position schon in jungen Jahren.

Bereits bei der Begrüßung vor ihrem Vorgesetzten, dem Verwaltungsdirektor Paul Walakira, spricht sie die Lage im Distrikt mit harschen Worten an: «Man kann nicht stolz darauf sein, dass Kasese zu den Gebieten mit der höchsten Rate geschlechterbasierten Gewalt im Land zählt.» Die 47-Jährige kommt aus einem abgelegenen Dorf, in dem patriarchale Strukturen und Armut den Alltag prägen. Sie beschreibt ihre Kindheit: «Ich bin ein Mädchen vom Land, in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und habe wiederholt Kriege und Konflikte in meiner Heimat miterlebt.» Ihre Schulzeit war geprägt von Vertreibungen: «Von der ersten bis zur siebten Klasse habe ich vier verschiedene Schulen besucht. Wir wurden immer wieder vertrieben.»
Sie erzählt von einer Entführung durch eine Rebellengruppe: «Wir wurden damals aus der Schule verschleppt und in den Busch gebracht. Ich verbrachte dort drei Monate. »Ich habe noch Narben, von Schlägen und von einem Messer.« Lange noch nach der Entführung bereiteten diese Wunden ihr Schmerzen, erzählt sie, während sie auf ihr ausgestrecktes Bein zeigt.
»Viele Frauen sind sichtbar in Positionen, aber die Mehrheit bleibt sozial und wirtschaftlich benachteiligt.«
Bildung war für die Politikerin der Schlüssel zu eigener Selbstbestimmung. Zurück in die Schule zu gehen, nannte sie einen Wendepunkt ihres Lebens. Heute hat sie einen selbst finanzierten Master in Gender- und Entwicklungsstudien. Bereits als 18-Jährige wurde sie in eine politische Position gewählt, um die Frauen ihres Dorfes zu vertreten. Seit 2007 arbeitet sie für den Verwaltungsdistrikt Kasese, aktuell als leitende Beauftragte für Gemeindeentwicklung. Sie beschreibt sich als stolze alleinerziehende Mutter von drei Kindern und sagt, die größten Herausforderungen lägen darin, dass die meisten Frauen vor Ort nicht selbstbestimmt handeln könnten. Gleichzeitig kritisiert sie die kulturelle Sturheit der Gesellschaft, in der Frauen mit wenigen Kindern oft weniger Respekt erfahren als jene, die acht oder mehr Kinder haben. Asiimwe nennt die wirtschaftliche Lage der Frauen im Distrikt prekär. Sie seien kaum selbstbestimmt, sagt sie, und selbst wer ein eigenes Geschäft führe, werde oft nicht als Besitzerin anerkannt. Vielmehr heiße es weiterhin, das sei das Geschäft des Mannes. Das mache die Frauen verwundbar, selbst wenn sie versuchten, unabhängig zu sein. Auch Landbesitz sei von dieser Ungleichheit gekennzeichnet: Die Mehrheit der Frauen in Kasese besitze kein Land, obwohl der Distrikt, reich an Gemüse und Feldfrüchten, als »Lebensmittelkorb« gelte, fügt Asiimwe hinzu und zieht die Augenbrauen zusammen, als spüre sie die Wut über diese Ungerechtigkeit.
Auch in der Landwirtschaft tragen Frauen den Hauptteil der Arbeit. Sie pflanzen, ernten und pflegen die Felder, doch sobald es um Verkauf oder Einnahmen geht, übernehmen die Männer. Asiimwe erklärt, dass der Besitz der Ressourcen bei den Männern bleibe, selbst wenn die Frauen Produktion und Unternehmen am Laufen hielten. Sie könnten nicht besitzen, was sie leisten. Selbst das Smartphone einer Frau in Uganda gelte oft als Eigentum des Mannes.
Auf Distriktebene verzeichne Kasese jedoch Fortschritte. Mehr als 30 Frauen seien im Distriktrat vertreten, und am Hauptsitz des Distrikts leite eine Frau die Finanzen. Die Politikerin betont, dass Frauen in Führungspositionen nicht nur Zahlen verwalten, sondern auch dafür sorgen, dass frauenspezifische Themen ausreichend Mittel erhalten.
Sie weist auf das Paradoxon zwischen formaler Repräsentation und sozialer Realität hin. »Wir haben Frauen in Führungspositionen, im Parlament, in Schlüsselämtern, gleichzeitig eine Gesellschaft, in der Gewalt und patriarchale Normen weitverbreitet sind«, bemängelt sie. Auf die Frage, wie sich das erklären lasse, antwortet sie: »Viele Frauen sind sichtbar in Positionen, aber die Mehrheit bleibt sozial und wirtschaftlich benachteiligt. Selbst wenn Frauen sich engagieren, ist ihr Anteil im Vergleich zu Männern winzig. Wir dürfen nicht aufhören, darüber zu sprechen. Männer müssen hervortreten und Frauen unterstützen.« Trotz Armut, Konflikten und patriarchaler Strukturen setzen Frauen in Kasese ihre Rechte durch. Sie handeln eigenständig, nutzen Ressourcen und sichern das Überleben ihrer Familien. Ermächtigung, Schulungen und politische Sensibilisierung sind entscheidend, damit sie Schutz und Stabilität erlangen. »Mütter müssen gestärkt werden, damit ihre Kinder nicht nur überleben, sondern auch selbstbewusst ihre Geschichten erzählen können«, rät Asiimwe zum Schluss.
Zwischen Acker, Laden und Schule
Abankoha Kasifa, 63, ist in ihrem Dorf nahe der westugandischen Stadt Kyegegwa als »Beraterin des Dorfes« bekannt. Alle nennen sie liebevoll »Tante«, weil sie für jedes Problem und jede Sorge einen Ratschlag bereithält. Wenn sie lacht, und das tut sie oft, drehen sich die Köpfe zu ihr. Ihr Lachen ist laut und ansteckend, manchmal bricht es mitten im Satz hervor, als könne sie sich selbst am meisten über das Leben wundern. Auch wenn sie von ernsten Dingen spricht, bleibt ihr Blick offen und freundlich, fest auf ihr Gegenüber gerichtet.
An diesem Vormittag trägt sie eine grüne Abaya mit weißen Stickereien, eine goldene Gürtelschnalle an der Taille, dazu einen leuchtend roten Hijab und schwarze Lackschuhe. In der einen Hand hält sie ein pinkes Notizbuch, in der anderen ihr Handy, auf dem sie stolz die Fotos ihres Esels zeigt. »Mein Esel heißt Happy, weil ich auch glücklich bin«, sagt sie und lacht wieder.
Wir gehen gemeinsam durch die staubige, laut befahrene Straße in Richtung Stadt, zu ihrem Laden. Die vorbeifahrenden Motorräder hupen, man muss den richtigen Moment abpassen, um heil über die Straße zu kommen. Vor dem vollgestopften Laden steht eine ihrer Töchter, die gerade Erdnüsse sortiert und in Körbe legt. Ihr Mann kommt dazu, lacht laut, reißt einen Witz – er scheint denselben Sinn für Humor zu haben wie sie. Abankoha zeigt auf die Säcke mit frisch geernteten Bohnen, erzählt, wie viel Arbeit in jeder einzelnen steckt und dass sie am liebsten alleine auf dem Feld stehe. Auf die Frage, warum sie nicht selbst im Laden arbeiten wolle, winkt sie ab: Sie sei lieber auf dem Acker, »die Stadt, der Verkehr, das Chaos – das ist nichts für mich.«

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Als Frau einen eigenen Laden zu besitzen und selbst über die Abläufe zu bestimmen, ist in Uganda keine Selbstverständlichkeit. »Ich wollte zuerst auf eigenen Beinen stehen, bevor ich einen Mann heirate«, sagt sie. Das Haus, in dem sie heute lebt, hat sie Stein für Stein selbst gebaut und bezahlt mit dem, was sie mit ihrer Ernte verdient hat. Erst später kam der Ehemann dazu. »Hier in Uganda müssen viele Frauen die Polygamie akzeptieren, aber ich bin die einzige Frau meines Mannes«, sagt sie und lächelt verschmitzt, als genieße sie den Gedanken an ihre Unabhängigkeit. Sie glaubt, dass ihre Selbstständigkeit nicht nur ihr eigenes Leben verändert hat, sondern auch anderen Frauen als Beispiel dient.
Neben ihrer Arbeit als Bäuerin und Ladenbesitzerin – »aber ich bin die Chefin«, betont sie –, engagiert sie sich in der Dorfschule als Vermittlerin und Beraterin. »Ich spreche oft mit den Eltern«, erzählt sie. »Ich sage ihnen, dass ihre Kinder vor der Schule etwas essen müssen. Mit leerem Bauch kann man nicht lernen.« Sie berät Familien, gibt Ratschläge zum Umgang mit den Kindern und schlichtet Konflikte im Dorf. Parallel dazu versorgt sie zwölf Kinder, eigene und Enkel; die meisten leben mit ihr im Haus. Mehrere weibliche Verwandte haben wie sie einen eigenen Verkaufsstand.
Aus den Erzählungen der Frauen wird spürbar, wie groß die Kluft zwischen rechtlichen Möglichkeiten und gesellschaftlicher Realität bleibt. Auf dem Papier haben sie Rechte, in der Praxis aber bestimmen Tradition, Armut und alte Erwartungen ihr Leben. Viele bearbeiten das Land, dürfen es jedoch nicht verkaufen. Stirbt der Ehemann, gehört ihnen zwar das Haus, doch eine neue Partnerschaft gilt als unschicklich. In dieser Spannung zwischen Gesetz und Gewohnheit vollzieht sich allmählich ein Wandel. Frauen beginnen, ihre Rechte zu leben, sie beraten einander, gründen Geschäfte, bilden Netzwerke. Schritt für Schritt verschieben sie die Grenzen dessen, was in ihren Dörfern möglich ist.
Die Reise zu Recherchezwecken fand im Rahmen einer Exkursion der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V. (DGVN) statt.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.