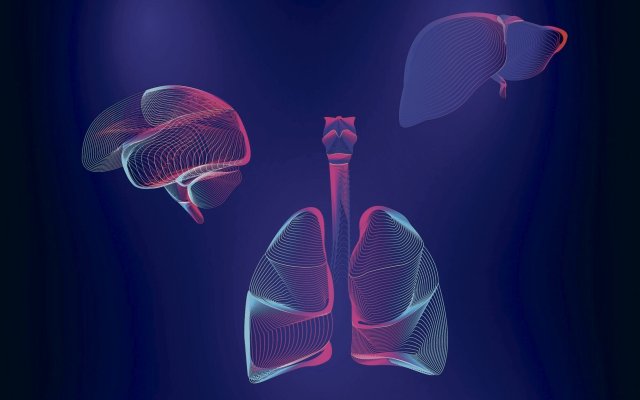- Wissen
- Gruppenidentitäten
»Wie wir über die Realität reden, bestimmt unser Verhalten«
Die Anthropologin Anne Pisor spricht über Gruppenidentitäten, die falsche Vorstellung vom »Wir gegen die anderen« und über Empathie als Schlüssel
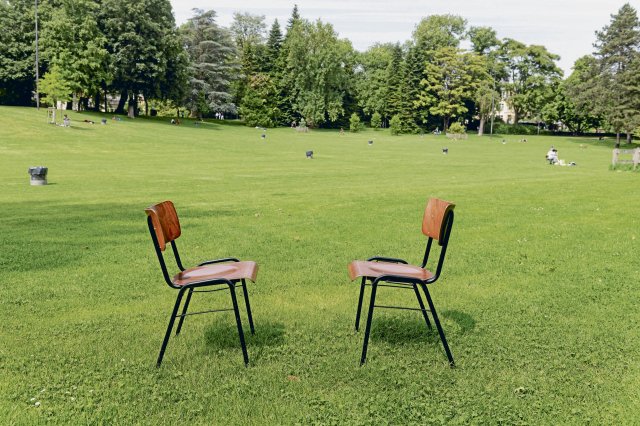
In den gegenwärtigen Krisenzeiten scheinen Identitätsdenken, Gruppenzugehörigkeiten und exklusive Solidarität weitverbreitete Phänomene zu sein. Sie haben am Leipziger Max-Planck-Institut den Einfluss von Gruppenidentität auf Zusammenarbeit untersucht. Dahinter wird oft ein »Parochial Altruism« genanntes Phänomen vermutet, so etwas wie begrenzte Mildtätigkeit. Was ist damit gemeint?
Ja, das ist so ein akademischer Begriff. Manchmal spricht man von Stammesdenken. Das bedeutet, dass man der eigenen Gruppe hilft und andere Gruppen verletzt. Nicht nur in der Wissenschaft, auch in der öffentlichen Meinung ist die Annahme verbreitet, dass beides zusammengehört. Nach dem Motto: Meine Gruppe zuerst, egal ob das anderen schadet.
Aber ist das ein Mythos?
Es ist kein Mythos, aber auch nicht allgemeingültig. Der Mensch ist hypersozial, Gruppen sind uns wichtig. Ob diese Gruppen jedoch konkurrieren, hängt von der Überzeugung ab, dass es etwas gibt, worüber es sich zu konkurrieren lohnt.

Anne Pisor ist Assistent-Professorin für Anthropologie und Demografie an der Penn-State-Universität in State College, Pennsylvania. Sie untersucht, wie Menschen Risiken managen. Sie ist assoziierte Forscherin am Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie.
Ihre Feldstudie, die Sie zusammen mit dem Anthropologen Cody Ross durchführten, fordert die Ansicht der Gruppenkonkurrenz heraus.
Ja, wir waren neugierig, ob dieses »Wir gegen andere« wirklich menschliches Verhalten bestimmt und welchen Faktoren es unterliegt. Offensichtlich ist ja nicht immer die Gruppenidentität entscheidend. Wir haben uns auf Identitätsgruppen fokussiert, das können ethnische oder religiöse Gruppen sein, politische Gruppen oder Fußballklubs.
Wie haben Sie die Gruppen ausgewählt?
An unserer Studie in Kolumbien nahmen zwei ethnische Gruppen teil, eine afrokolumbianische und die indigenen Emberá. Wir untersuchten in zwei Gemeinden die Beziehungen zwischen diesen Gruppen. In beiden sind die Afrokolumbianer reicher, haben besseren Zugang zu Strom und Wasser. Was die Gemeinden unterscheidet, ist ihre Umgebung. Die eine Gemeinde liegt an der ethnischen Grenze zwischen den großen Siedlungsgebieten beider Gruppen. Die dort lebenden Emberá haben etwas Geld. Die andere liegt von der Grenze entfernt an der Küste, wo die Emberá unter schwierigeren Bedingungen leben. Also obwohl die Gemeinden selbst sehr ähnlich sind, ist der Rahmen um sie herum verschieden. Sie sehen Nachbargemeinden in verschiedenen Lebensbedingungen. Das verändert das Verhalten.
Wie gestalteten Sie das Studiendesign?
Individuen der Gruppen nahmen an einem Wirtschaftsspiel teil, bei dem sie Fotos von Menschen ihrer Gemeinschaft, ihrer eigenen ethnischen Gruppe und der anderen ethnischen Gruppe sahen. Sie kannten diese Menschen und konnten wählen, ob sie ihnen Geld geben, Geld belassen oder dafür bezahlen wollten, ihnen Geld wegzunehmen. Diese dritte Aufgabe gab die Möglichkeit, andere wirklich zu bestrafen. Bei den Entscheidungen sprachen die Teilnehmer über vergangene Erfahrungen mit den Menschen, gerade aus der anderen Gruppe.
Was ist in diesen Situationen geschehen?
In der Küstengemeinde waren die Afrokolumbianer viel eher dazu geneigt, den Emberá das Geld zu lassen, zum Teil waren sie eher dazu bereit als gegenüber Afrokolumbianern. Weil sie durch ihre Umgebung wussten, dass die Emberá weniger zu Verfügung hatten, leitete das ihr Handeln an. Das war in der anderen Gemeinde nicht der Fall. Teile der Probanden verhielten sich nicht automatisch so, dass sie mit eigenen Gruppenmitgliedern kooperierten und die anderen ablehnten. Stattdessen achteten sie auf die Bedürfnisse und das frühere Verhalten anderer – oder das, was sie aus deren Gruppenidentität abzuleiten meinten.
Das bedeutet, dass Empathie oder Solidarität stärker ins Gewicht fielen als die Gruppenidentität?
Empathie gehört zum Menschen. Und sie kann aktiviert werden durch die Wahrnehmung von Ungleichheit. Das ist nicht notwendigerweise so, aber kann der Fall sein. Weil die Menschen im Inland um sich herum Emberá sahen, denen es ganz gut ging, nahmen sie das auch für jene in ihrer Gemeinde an. In der küstennahen Gemeinde hingegen herrschte Einigkeit, dass die Indigenen weniger privilegiert sind. Das Bezugssystem, in dem man lebt, spielt eine Rolle. Die Entscheidung, ob eine andere Gruppe eine Bedrohung darstellt, hängt von Faktoren wie früheren Erfahrungen mit dieser Gruppe ab, von dem, was andere über die Gruppe erzählt haben. Und es hängt davon ab, ob es etwas gibt, das beide Gruppen wollen, aber nur eine haben kann. All diese Faktoren laufen in unserem Gehirn zusammen und können ein »Wir gegen die«-Denken auslösen.
Dass Hilfsbereitschaft nicht entlang »natürlicher« Grenzen der Gemeinschaft verläuft, zeigt auch die evolutionäre Rolle der Fähigkeit zur Kooperation, oder?
Sie zählt zum Kern dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Wir kooperieren wie kaum eine andere Spezies miteinander. Und wir leben in Gruppen, weshalb Kooperation oft in diesen Gruppen organisiert wird. Aber das muss nicht immer der Fall sein.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Dieser Gruppenbezug führte unter anderem zur falschen Annahme, der Homo sapiens habe den Neandertaler bekriegt. Sind Gruppenidentitäten also flexibler?
Exakt. Natürlich gibt es Gruppen, die um Ressourcen konkurrieren. Wir verlassen uns aber auf große soziale Netzwerke. Das kann die internationale wissenschaftliche Community sein oder das Dorf in Deutschland. Dort hat man Nachbarn, die nicht unbedingt der gleichen politischen Partei angehören oder demselben Fußballklub zujubeln. Dennoch verlässt man sich auf sie. Unsere soziale Beziehungen ziehen sich durch verschiedene Gruppen hinweg. Diese Gruppengrenzen spielen dann eine viele kleinere Rolle.
Ihre Forschung kann helfen, Gesellschaften anders zu denken. Sie begreifen diese als komplexer, nicht in monolithische Blöcke unterteilt, wie die Rede über Spaltung gemeinhin nahelegt.
Das hoffe ich. Wir Menschen sind flexibel, was unsere Beziehungen zu Gruppen angeht. Aus der Sozialpsychologie stammt die Idee der übergeordneten Identität. Das meint, unsere Identität übersteigt Gruppenzugehörigkeiten wie Ethnie oder Glauben. Hobbys sind dafür ein schönes Beispiel. Für Spieler von Rollenspielen wie »Dungeons and Dragons« oder anderen Onlinespielen ist es egal, woher die anderen Teilnehmenden kommen. Gemeinschaften sind nicht nur darüber organisiert, ob man links oder rechts ist, reich oder Teil der unteren Arbeiterklasse und so weiter. Natürlich gibt es Situationen wie etwa bei einer Fußball-WM, wo es nur einen Gewinner geben kann. Im Zusammenleben ist das aber selten der Fall. Ressourcen können zum Beispiel geteilt werden.
Heißt das, die Konkurrenz zwischen Gruppen wird konstruiert?
Das ist am aktuellen politischen Diskurs zu beobachten. Da wird erzählt, dass die Ressourcen – etwa Geld, Status, Sicherheit – limitiert sind, und es wird auf andere Menschen gezeigt, die uns diese wegnehmen wollen. Und das aktiviert die »Wir gegen sie«-Mentalität. Es gibt die Realität, aber wie wir über sie reden, bestimmt das menschliche Verhalten. Das sieht man auch in der Geschichte, wo die Organisation entlang politischer Zugehörigkeit nicht so stark war oder der Unterschied zwischen heimisch und fremd weniger betont wurde als heute. Dessen müssen wir uns gewahr sein, um das »Wir gegen die anderen« nicht absolut zu setzen.
Um Ihre Erkenntnisse in die Praxis zu übersetzen: Was tun?
Ein Faktor ist menschliche Empathie. Jeder hat eine Familie, jeder kann harte Zeiten erleben, einen Job oder sogar einen Lieben verlieren. Und obwohl nicht alle zustimmen, dass der Klimawandel stattfindet, erleben sie Naturkatastrophen. Das verbindet uns alle und dort kann man beginnen.
Ich will damit nicht »pollyannaish« wirken, wie man hier in den USA sagt, also naiv-unrealistisch behaupten »Alles wird toll!«. Aber Empathie als Ausweg habe ich an vielen Orten der Welt erlebt. Wenn verschiedene Menschen in kleinen Räumen zusammenkommen können, am Runden Tisch, bei Gemeindetreffen, wo ein Austausch erfolgt. Meistens findet der über eine Sache statt, die alle beschäftigt. Ich lebte in Leipzig-Neulindenau. Man kann sich ein Treffen von Neulindenauern mit verschiedenen Identitäten vorstellen, die über die Gestaltung des Stadtteils sprechen. Ein geteiltes Interesse vereint alle. Dann fällt es leichter, die anderen Personen als Menschen anzusehen. Dazu muss natürlich der Wille vorhanden sein. Man sieht das auch in politischen Institutionen, wo ein gemeinsames Interesse verschiedene Gruppen zusammenbringen kann.
Welche Rolle spielt dabei Vertrauen?
Nun, das hängt davon ab, wie man Vertrauen definiert. Aber um es so zu sagen: In diesen Momenten, wenn wir uns in kleinen Gruppen verbinden und ein gemeinsames Interesse anerkennen, vertrauen wir den anderen, dass sie uns keinen Schaden zufügen wollen. Das ist die Basis gegenseitiger Anerkennung und möglicher Zusammenarbeit. Die Kraft solcher sozialer Erfahrungen sieht man beispielsweise bei Musikfestivals. Man trifft Fremde und freut sich über den Austausch.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.