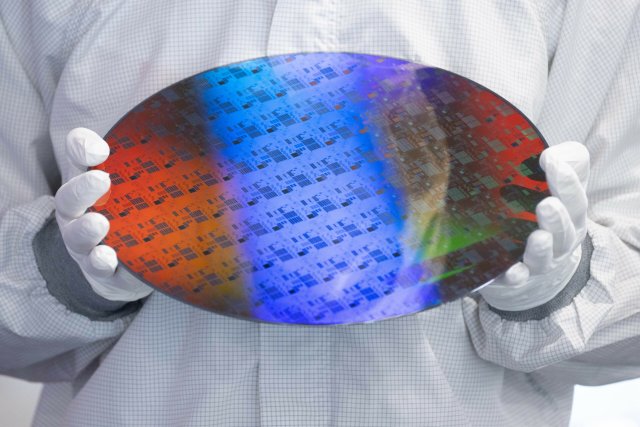- Wirtschaft und Umwelt
- Klimazerstörung
Oxfam-Bericht: Teufelskreis der Klimaplünderung
Neuer Oxfam-Bericht zeigt, wie Superreiche den Planeten zerstören und ihre eigene Macht sichern

Selbst der stärkste Mensch der Welt könnte die Menge an CO2 nicht stemmen, die eine Person aus dem reichsten 0,1 Prozent der Weltbevölkerung täglich verursacht. Über 800 Kilogramm durchschnittlich sind das, ein Gewicht von ungefähr elf Waschmaschinen. Doch sogar ein kleines Kind könnte das heben, was ein Mensch aus der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung verursacht: lediglich zwei Kilogramm.
Als »Klimaplünderung« bezeichnet die internationale Hilfsorganisation Oxfam diesen Umstand. Unter dem Titel hat sie diese Woche ihren jährlichen Bericht zur Emissionsungleichheit vorgelegt, der gleichzeitig ein Bericht der Machtungleichheit ist. Zudem gibt Oxfam politische Handlungsempfehlungen für eine »gerechte Transformation«, die laut den Autor*innen von jenen bezahlt werden sollte, die die Klimakrise vorrangig befeuern: Superreiche.
»Die Klimakrise ist eine Krise der Ungleichheit.«
Manuel Schmitt Oxfam Deutschland
Der Bericht erscheint pünktlich zur 30. UN-Weltklimakonferenz, die am 10. November im brasilianischen Belém starten wird. Während das Treffen vor zehn Jahren in Paris beschloss, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wurde diese Schwelle 2024 zum ersten Mal überschritten. Um das Ziel doch noch zu erreichen, müsste laut Oxfam das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung seine Emissionen pro Kopf bis 2030 um 97 Prozent verringern.
Dabei bezieht der Bericht in seine Berechnungen nicht nur Konsum-, sondern auch Investitionsemissionen ein. Oxfams Analyse des Aktienindex S&P Global 1200 von 1200 der größten börsennotierten Unternehmen ergab, dass fast 60 Prozent der Investitionen von Milliardären in für das Klima hoch schädlichen Sektoren stattfinden, wie Bergbau und Öl.
Der Bericht beleuchtet systemische Ungleichheiten, die sich am diesjährigen Ort der Weltklimakonferenz bündeln. Die Bewohner*innen von Vila da Barca, einer Pfahlbausiedlung in Belém, leben in »palafittes« am Wasser und stehen an der »Frontlinie der Klimakrise«. Mehrere Monate im Jahr steigen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad, bei Hochwasser gibt es kaum Schutz. Daneben können sie die Hochhäuser der reichen Viertel in den Himmel ragen sehen.
Eine Analyse des internationalen Bündnisses Kick Big Polluters Out ergab, dass an der vorherigen Weltklimakonferenz 1773 Kohle-, Öl- und Gaslobbyisten teilnahmen. Nur drei Teilnehmerländer überhaupt kamen auf Delegationen dieser Größe. Ein exemplarisches Beispiel für das, was die Autor*innen einen »Teufelskreis« nennen: Dieselben Machtverhältnisse, die die Ungleichheit befeuern, ermöglichen es den Unternehmen, ihre Macht zu sichern.
So ist es kein Zufall, dass Superreiche gezielt rechte Bewegungen unterstützen. Diese leugneten zum einen den Klimawandel und lenkten zum anderen durch gesellschaftliche Hetze von ihm ab, meint Oxfam. Die Fracking-Milliardäre Farris und Dan Wilks spendeten Millionen an rechte Medienorganisationen. Die Autor*innen warnen vor den Folgen wie ansteigender Diskriminierung. Laut UN Women, einer Unterorganisation der Vereinten Nationen, durchlebte eins von vier Ländern im Jahr 2024 einen Rückschlag für Frauenrechte.
Auch der Donors Trust, eine Förderorganisation in den USA, ließ Millionen US-Dollar in Großspenden an Gruppen weiterfließen, die den Klimawandel infrage stellen. Während sich der Donors Trust laut einem Artikel der Zeitung »Independent« zu einem der Hauptakteure in der Klima-»Gegenbewegung« emporhob, verrät er nichts über seine Spender*innen.
»Die Klimakrise ist eine Krise der Ungleichheit«, sagt Manuel Schmitt, Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland. »Superreiche setzen unseren Planeten in Brand, während die Ärmsten, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, schon heute massiv von ihren Folgen getroffen werden.«

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Darum schlägt der Bericht politische Maßnahmen vor wie die Transformation besonders klimaschädlicher Sektoren und die Einführung eines sozial gestaffelten Klimagelds. »Ein erster Schritt wäre die im Rahmen der G20 diskutierte Mindeststeuer von zwei Prozent für Multimillionär*innen und Milliardär*innen«, meint Schmitt. Noch grundsätzlicher fordert Oxfam, eine Wirtschaft aufzubauen, die sich am Gemeinwohl orientiert.
Die Zivilgesellschaft solle an den Tisch geholt werden, damit politische Entscheidungen auch von jenen getroffen werden, die betroffen sind. Bei der jüngsten Weltklimakonferenz vertraten lediglich 180 von über 50 000 Teilnehmer*innen indigene Völker.
Die Augen der internationalen Gemeinschaft richten sich bereits auf die bevorstehende Konferenz in Belém. Dort entsteht neben Vila da Barca eine neue Kläranlage. Anstatt der lokalen Gemeinschaft zu nützen, soll sie den Teilnehmer*innen der Weltklimakonferenz dienen – ein erneutes Zeugnis der Klima- als Ungerechtigkeitskrise. Der Abfall der Bauarbeiten daneben stapelt sich.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.