- Wirtschaft und Umwelt
- Weltwirtschaft
USA und China: Schlagen und Vertragen
USA und China verhandeln nur miteinander auf Augenhöhe. Ein partieller Handelsdeal könnte die Folge sein

Werden Xi Jinping und Donald Trump an diesem Donnerstag den großen Deal verkünden? Noch bis vor Kurzem war offen, ob es am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südkoreanischen Busan überhaupt zu einem bilateralen Treffen der beiden Präsidenten kommen wird. Die Regierung in Washington überlegte, die Lieferung von Produkten nach China einzuschränken, die US-Software enthalten. Doch statt dieser neuerlichen Eskalation stehen die Zeichen nun auf Entspannung: »Ich habe großen Respekt vor Präsident Xi, und ich denke, wir werden eine Einigung erzielen«, sagte Trump Anfang der Woche.
Nach bilateralen Verhandlungen am vergangenen Wochenende sprach bereits sein Finanzminister Scott Bessent von »erfolgreichen Rahmenbedingungen« für das bevorstehende Gipfeltreffen. Die von Trump angekündigten zusätzlichen Strafzölle in Höhe von 100 Prozent seien »effektiv vom Tisch«. Im Gegenzug werde China seine Exportkontrollen bei seltenen Erden aussetzen, verstärkt Sojabohnen aus den Vereinigten Staaten importieren und beim Kampf gegen Fentanyl – jenes Opiat, dessen Vorprodukte oft aus chinesischen Labors stammen und das in den USA zu einer horrenden Drogenepidemie geführt hat – mitarbeiten. Kurzum: In praktisch allen Streitfragen scheinen die zwei Seiten Kompromisse gefunden zu haben.
Ob die freilich stabil sein werden und auch alle wichtigen Details umfassen, gilt angesichts der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren aber als unwahrscheinlich. Schon als US-Präsident Barack Obama 2011 seinen »strategischen Schwenk« nach Asien einleitete, begannen die US-chinesischen Beziehungen allmählich ungemütlich zu werden. Sein Nachfolger Trump verschärfte den Konflikt genauso wie danach Joe Biden, der den wirtschaftspolitischen Werkzeugkasten um Tech-Sanktionen erweiterte. Chinas Volkswirtschaft ist mittlerweile von führender Chip-Technologie des Westens abgeschnitten. Davon ließ man sich aber nicht beeindrucken und wartete zuletzt selbst mit ersten spektakulären Ergebnissen etwa im KI-Bereich auf. Und der derzeit diskutierte 15. Fünf-Jahres-Plan der Volksrepublik sieht für die Zeit von 2026 bis 2030 als Kernziel neben wirtschaftlicher Resilienz und nationaler Sicherheit auch die technologische Eigenständigkeit vor.
China und USA auf einander verwiesen
Die vergangenen Monate zeigten: Selbst absurd hohe Strafzölle der Trump-Administration schrecken die chinesische Staatsführung nicht. Sie reagierte, anders als etwa die EU-Spitzen, konsistent mit Gegenmaßnahmen – und spielte zuletzt mit Exportbeschränkungen bei einigen der strategisch wichtigen seltenen Erden ihren ersten Joker aus. Deutlich wurde die Grundkonstellation: Die USA haben ein dominantes Finanzsystem und die Technologieführerschaft in vielen Bereichen. China hingegen ist der mittlerweile wichtigste Markt und Produktionsstandort für viele Konzerne sowie internationale Mittelständler weltweit, zudem ist die Weltwirtschaft von bestimmten Rohstoffen abhängig, die zu großen Teilen in China gewonnen und zu noch größeren Teilen dort weiterverarbeitet werden. Washington und Peking sind bei allem Dominanzgehabe gezwungen, sich immer wieder zusammenzuraufen.
Dass von dem ständigen Hin und Her auch unbeteiligte Dritte getroffen werden, ist ihnen herzlich egal. Entwicklungsländer trifft dies am härtesten, aber auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul (SPD) bekam dies vor einigen Tagen zu spüren – er musste seinen Antrittsbesuch nach Peking absagen, da er kaum relevante Gesprächspartner fand. Das mag mit seiner, aus Sicht Pekings, »falschen Sicht« auf die Taiwan-Frage zu tun haben, aber mehr noch mit der schwindenden Bedeutung der Europäer (einschließlich Russlands). Ganz offensichtlich verhandeln die Volksrepublik und die Vereinigten Staaten nur miteinander auf Augenhöhe. Das zeigt sich auch beim bis zum Wochenende laufenden Apec-Gipfel, wo sich alles um Xi und Trump dreht, obwohl 21 Staaten dem weltgrößten Wirtschaftsraum angehören.
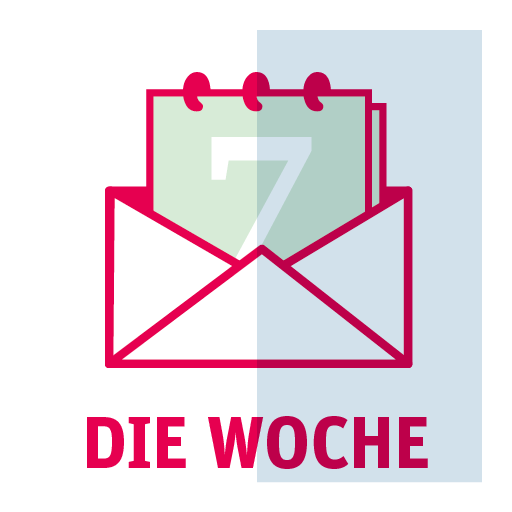
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Das musste vor wenigen Tagen auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einräumen: »Eine Krise in der Versorgung für kritische Rohstoffe ist nicht länger ein entferntes Risiko«, sagte die CDU-Politikerin im Europaparlament. Während China die Exporte beschränkt, decken sich die USA bei anderen Lieferanten ein. Bisherige Anstrengungen, Europas Versorgung bei kritischen Rohstoffen sicherzustellen – durch Partnerschaften mit allen möglichen Ländern von Kanada und Chile über Australien und Brasilien bis zur Mongolei und Kasachstan – scheinen nur teilweise erfolgreich zu sein. Das gilt auch für die größte EU-Volkswirtschaft: Zwar wurden zuletzt nur noch 35 Prozent aller in Deutschland verwendeten seltenen Erden aus dem Reich der Mitte eingeführt (2020: 73 Prozent). Die Zahlen schwanken allerdings stark, je nachdem, um welches Element es genau geht.
Wenig Auswirkungen, große Risiken
Und so ist es nicht überraschend, dass die Handelsspannungen China-USA bisher kaum Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben, in allen Konjunkturprognosen aber als größte Unsicherheit genannt werden, auch für das europäische Wirtschaftswachstum: Der Chefvolkswirt der Berenberg-Bank, Holger Schmiedin, erläutert, wenn China weniger in die USA importiert, worauf Donald Trump abzielt, könnte es versuchen, subventionierte Exporte umzuleiten, was die Ausfuhren Europas gefährden könnte.
Ein anderer, bislang ignorierter Teil des Konflikts ist gerade aufgeploppt. Lange vor dem Machtwechsel im Weißen Haus hatte zuerst Washington Sanktionslisten mit chinesischen Firmen erstellt, die von Geschäften ausgeschlossen werden sollen. Peking reagierte mit ähnlichen Listen. Das hatte bisher geringe Folgen, aber vor wenigen Tagen sorgte die Meldung für Aufregung, dass VW wegen Versorgungsmangels mit Halbleitern aus China an diesem Mittwoch Produktionsstopps verhängen muss. Dazu kommt es – zumindest vorerst – nicht, aufgrund politischer Bemühungen im Hintergrund und der Suche von Europas größtem Autobauer nach alternativen Bezugsquellen. Dennoch zeigt der Fall, dass Unbeteiligte beim Streit zwischen den beiden Wirtschaftsgroßmächten unter die Räder kommen können.
Gestörte Lieferketten wurden schon seit der Corona-Pandemie zum Problem. Die Kostensenkungen durch Just-in-time-Produktion und reduzierte Lagerhaltung sorgen bei allzu großer Abhängigkeit von einem Lieferanten für zusätzliche Anfälligkeit, unter anderem bei Chips. Daher wäre eine staatliche Industriepolitik wichtig: »Statt eine eigenständige europäische Halbleiterstrategie zu entwickeln, hat die Bundesregierung jahrelang die Abhängigkeit von US- und chinesischen Konzernen zugelassen«, kritisiert Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Linkspartei. »Wir brauchen dringend einen Krisenplan für Halbleiter und eine Investitionsoffensive, besonders im Osten.«
Hier wie auch in anderen Bereichen dürfte eine Annäherung Chinas und der USA zwar für gewisse Entspannung sorgen. Aber da das Verhältnis der beiden Wirtschaftsgroßmächte konfliktbeladen bleiben wird, gehen die meisten Beobachter davon aus, dass es beim Hin und Her der vergangenen Monate bleiben wird: mit Drohungen und dann wieder versöhnlichen Tönen, mit Eskalation auf einigen Gebieten und partiellen »großen« Deals.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.







