- Politik
- 70 Jahre Bundeswehr
70 Jahre Bundeswehr: »Ohne mich!«
Die Bundeswehr wird 70 – Proteste gegen sie gibt es schon länger

In einer Wagenhalle der Bonner Ermekeilkaserne übergibt der Verteidigungsminister Theodor Blank (CDU), ein christlicher Gewerkschafter, am 12. November 1955 die Ernennungsurkunden an die ersten 110 Offiziere und Unteroffiziere der Bundeswehr. Wobei die ihren Namen noch gar nicht hat. Erst einmal ist nur von »Streitkräften« die Rede oder, wie in einem zeitgenössischen Radiobeitrag, von der »Bundeswehrmacht«. Ihren Namen bekommt die Bundeswehr erst am 1. April 1956.
Viele Fragen rund um die Bundeswehr werden im laufenden Betrieb diskutiert und beantwortet. Das gilt auch für politische Weichenstellungen. Begleitet werden sie von Anfang an von Protesten. Der Korea-Krieg ist für Bundeskanzler Konrad Adenauer Anlass, um über einen »deutschen Wehrbeitrag« nachzudenken. Der soll im europäischen Rahmen erfolgen; bis sie 1954 an der französischen Nationalversammlung scheitert, ist sogar eine »Europäische Verteidigungsgemeinschaft« in der Debatte. Schon die Gedankenspiele über deutsche Soldaten in einer europäischen Armee sorgen für Proteste gegen eine Wiederbewaffnung Deutschlands. Unter dem Motto »Ohne mich!« werden ganz unterschiedliche Stimmen und Motivationen zusammengefasst. Ein wichtiger Treiber des Protests ist die evangelische Kirche. Rund um den NS-Gegner Martin Niemöller und Gustav Heinemann, der wegen der Wiederbewaffnungsdebatte 1950 als Bundesinnenminister zurücktrat, entwickelte sich eine Bewegung. Neuwahlen wurden gefordert, weil eine Remilitarisierung 1949 noch kein Thema gewesen sei. 1951 wurde sogar eine Volksbefragung zur Wiederbewaffnung initiert und dann vom Bundesinnenministerium verboten, weil sie die freiheitlich demokratische Grundordnung »untergrabe«. Trotzdem wurden unter widrigen Umständen tausende Stimmzettel eingesammelt.
Eng mit der Repression gegen die Volksbefragung ist auch die Unterdrückung der kommunistischen Opposition verbunden. Parallel zum Verbot der Volksbefragung wurde im April 1951 auch die FDJ in NRW verboten. Zwei Monate später erfolgte das Verbot in ganz Westdeutschland. Auch der Straßenprotest war gewaltsamen Repressionen ausgesetzt. Im Mai 1952 wurde in Essen ein junges FDJ-Mitglied bei einer verbotenen Demonstration gegen die Remilitarisierung von einem Polizisten erschossen.
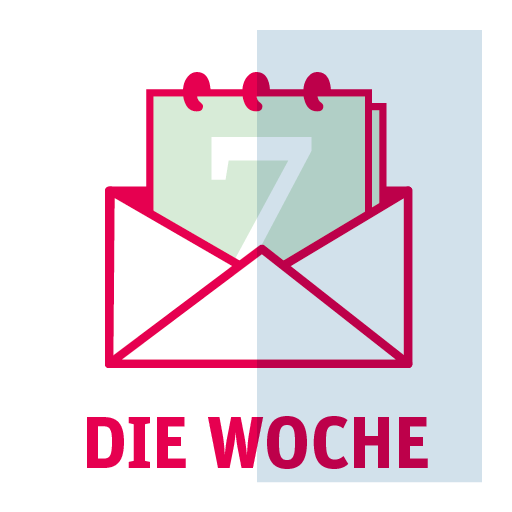
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Bis 1955 flauten die Proteste ab. Dann aber, nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und mit der Ankündigung, die Bundesrepublik als großteils souveränen Staat in die Nato aufzunehmen, wuchsen sie wieder. Ein Grund dafür: die massive Beteiligung der SPD. Die Sozialdemokrat*innen vertraten, bis zur Verabschiedung des Godesberger Programms 1959, eine strikt neutrale Haltung und forderten, dass Deutschland und Europa sich nicht an der Blockkonfrontation beteiligen. Sozialdemokrat*innen, Gewerkschafter*innen, Christ*innen und andere kamen in der »Paulskirchenbewegung« zusammen. Sie sollte, da Adenauer im Parlament über eine Mehrheit verfügte, für zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen eine deutsche Armee und den Nato-Beitritt eintreten. In einer »Deutsches Manifest« genannten Erklärung, die bundesweit zehntausende Menschen unterschrieben, hieß es: »Die Aufstellung deutscher Streitkräfte in der Bundesrepublik und in der Sowjetzone muss die Chancen der Wiedervereinigung für unabsehbare Zeit auslöschen und die Spannung zwischen Ost und West verstärken. Eine solche Maßnahme würde die Gewissensnot großer Teile unseres Volkes unerträglich steigern.«
Der Protest hat keinen Erfolg. Die Bundesrepublik wird Teil der Nato, die Bundeswehr wird gegründet. Im Januar 1956 ziehen die ersten Freiwilligen in die Kasernen ein. Während das Recht auf Kriegsdienstverweigerung seit 1949 im Grundgesetz steht, gibt es noch keine Wehrpflicht. Diese wird erst im Juli 1956 nach einer intensiven Debatte im Bundestag beschlossen. Ein Argument der Befürworter von CDU/CSU: Man könne nur mit der Wehrpflicht eine Armee mit 500 000 Soldaten aufstellen, wie man es der Nato versprochen habe. Eine Zahl an Soldaten, die die Bundeswehr in ihrer ganzen Geschichte nicht erreichen sollte.
Die dritte große Protestwelle rund um die Gründung der Bundeswehr gab es ab 1957, als immer stärker eine atomare Bewaffnung der deutschen Streitkräfte debattiert wurde. Besonders berühmt wurde die »Göttinger Erklärung« von 18 Naturwissenschaftlern, die sich gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr stellten. Deutsche Atombomben scheiterten auch am Widerstand aus Frankreich. Gegen die atomare Bewaffnung der Nato und die atomare Teilhabe Deutschlands wurden die ersten Ostermärsche organisiert. Eine Protestform aus den frühen Tagen der Bundeswehr, die es bis heute gibt.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.






