- Wissen
- Gentechnologien
Fortschritt und Regulation
Sozialwissenschaftliche Studien widersprechen der Vorstellung, die Regulierung gentechnisch veränderter Pflanzen sei vor allem eine Hürde

Die neuen Gentechnologien wie Crispr-Cas und Co. haben die Möglichkeiten enorm erweitert, die Biologie von Organismen zu erforschen und zu verändern. Forschende arbeiten daran, Nutzpflanzen mit Crispr zu entwickeln und versprechen sich davon die Erzeugung von klimaresilienten oder nährstoffangereicherten Pflanzen. Dass diese Pflanzen angebaut, international gehandelt und konsumiert werden sollen, stellt Behörden weltweit vor die Herausforderungen, die bestehenden Gesetze zur Gentechnik mit den neuen Methoden abzugleichen. Daher werden seit einigen Jahren die internationalen und nationalen Gesetze für den Umgang mit gentechnisch veränderten (gv) Organismen an die neuen Technologien angepasst. In den begleitenden Debatten erscheinen die Positionen zur Regulierung der neuen Gentechnik oft unvereinbar mit deren Anwendung oder Erforschung. Große landwirtschaftliche Verbände, Agrarkonzerne und Forschungsinstitute der Pflanzengenetik nehmen Regulierung eher als Hemmnis in der Entwicklung und Vermarktung von gv-Pflanzen wahr.
Regulierung ist jedoch mehr als eine Hürde oder ein Wettbewerbsnachteil. Sie bildet einen gesellschaftlichen Prozess ab, der darauf abzielt, Schäden für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden sowie Transparenz zu schaffen. Die Wahrnehmung darüber, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und wie die Prüfung erfolgt, ist zudem ein wichtiger Aspekt für das Vertrauen, das die Gesellschaft in ein Produkt oder Technologie entwickelt. Ein verstärkter Fokus auf die Möglichkeiten, die eine gesetzliche Regulierung bietet, kann beim gegenseitigen Verständnis helfen.
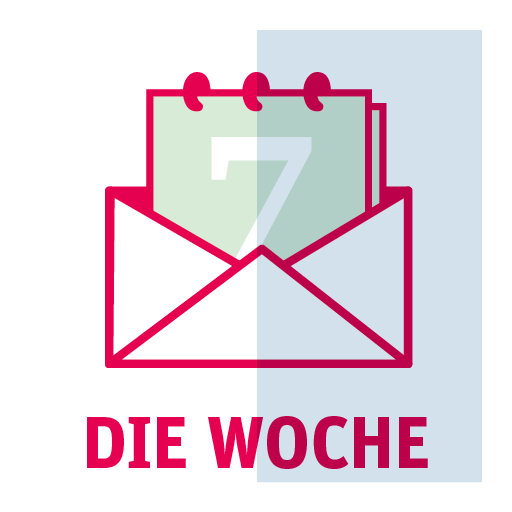
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Fortschrittshemmnis Regulation?
Wirtschaft und Forschung zufolge beeinträchtigten Risikoforschung und begrenzte Freilandtestflächen, Wartezeiten im bürokratischen Prozess und verpflichtende Kennzeichnung die zügige Entwicklung neuer Pflanzensorten sowie den Markteintritt neuer Unternehmen. Schaut man sich die Kostenverteilung für die Entwicklung einer neuen gv-Pflanze an, wird deutlich, dass der gesamte Prozess der Regulierung tatsächlich einen großen Anteil der zeitlichen und finanziellen Ressourcen ausmacht.
Eine Studie im Auftrag vom Agrarchemieverband CropLife International von 2022, die auf einer Umfrage bei den großen Agrarunternehmen Bayer, Corteva, Syngenta und BASF basiert, untersuchte den zeitlichen und finanziellen Aufwand, um eine Gentechnik-Pflanze zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Demnach dauert dieser Prozess durchschnittlich 16,5 Jahre und kostet rund 115 Million Dollar. Etwa die Hälfte der Zeit und circa 37 Prozent der Gesamtkosten entfallen darauf, die Anforderungen der Regulierung zu bearbeiten. Der Großteil dieser Kosten, nämlich 32,9 Millionen Dollar, wird für die wissenschaftliche Arbeit aufgewendet, die für eine Zulassung in mehreren Ländern notwendig ist.
Dies stellt für einige Unternehmen durchaus eine Hürde dar. Gleichzeitig sehen die etablierten Unternehmen in ihrer Fähigkeit zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden eine wichtige Kompetenz und einen Wettbewerbsvorteil. Ihr Wissen über den Regulierungsprozess und bewährte Verfahren hüten sie wie ein Geheimnis.
Gesellschaftliche Innovation
Die Sozialwissenschaftler*innen Michail Ivanov, Emily Buddle und Rachel Ankeny von der Universität von Adelaide aus Australien haben die aktuelle Debatte um die Regulierung der Biotechnologien in der Saatgutentwicklung verfolgt. Sie appellieren an Wissenschaftler*innen in der Pflanzenentwicklung, Regulierung nicht als Hindernis zu betrachten, sondern als Filter für den Innovationsprozess.
Regulierung sei ein wichtiger Bestandteil des Prozesses, »da sie verschiedenen Öffentlichkeiten die Möglichkeit gibt, sich mit der Forschung auseinanderzusetzen«. Die Rückmeldungen dienten dazu, »zu verstehen, ob die technologische Anwendung über das Labor oder den Feldversuch hinaus als wünschenswert und nützlich angesehen wird«. Die Autor*innen argumentieren, dass eine Regulierung den gesellschaftlichen Frieden schützt, indem sie Schäden in der Gesellschaft oder Umwelt verhindert. Diese Aufgabe erfülle sie nicht nur durch Auflagen, sondern auch dadurch, dass sie einen Rahmen zur Diskussion unterschiedlicher Positionen biete. Ein Ergebnis dieses Diskurses könnte sein, dass sich die Akteur*innen »zu mehr Offenheit verpflichten, die zugrundeliegenden Werte und Annahmen anerkennen, Alternativen in Betracht ziehen und über vereinfachte Entscheidungen hinaus zu einer nuancierten Betrachtung« der eigenen Position oder Arbeit gelangen.
Ivanov und Kolleg*innen beschreiben in ihrem Artikel verschiedene Positionen, die in der wissenschaftlichen Literatur zur Debatte um die Regulierung des Genom-Editings vorkommen. Besonders bei Wissenschaftler*innen der Pflanzengenetik und -entwicklung dominiere die Ansicht, dass Genom-Editierung wegen seiner Vorteile nicht oder kaum reguliert werden sollte. Allerdings ist die Frage, wer auf welche Weise vom Einsatz der neuen Gentechnik profitieren könnte, von zentraler Bedeutung für viele Menschen und mindestens genauso wichtig wie Fragen der Biosicherheit. Die vielfältigen Aspekte anzuerkennen und als relevant für den gesellschaftlichen Prozess der Regulierung anzunehmen, wäre eine gute Grundlage, um gemeinsam eine sinnvolle Regulierung zu formen.
Für wen wird reguliert?
Der Reflexion stehen jedoch Hindernisse entgegen. So zeigt eine Studie von Wissenschaftler*innen der niederländischen Wageninngen Universität rund um Aischa So, wie sehr einige Wissenschaftler*innen der Pflanzenentwicklung sich selbst und ihre Arbeit als neutral und von der Gesellschaft losgelöst betrachten. Jene, die sich aktiv an der Debatte über die Regulierung der neuen Technologien beteiligen, nahmen eine anwaltschaftliche Rolle für eine Deregulierung ein und taten sich schwer damit, die Gültigkeit anderer Positionen anzuerkennen. Dabei ist die Rolle, die insbesondere den Naturwissenschaften zugesprochen wird, eine rational-neutrale, der viel Vertrauen aus der Gesellschaft entgegengebracht wird.
Dieses Vertrauen spielt auch in andere Wissenschaftsbereiche hinein. Klara Fischer hat zusammen mit einer Gruppe von Sozialwissenschaftler*innen unterschiedlicher Universitäten analysiert, wie in Artikeln zu Anwendungen von Biotechnologien in der Landwirtschaft Gesellschaft konstruiert wird. Die Autor*innen kommen zu dem Schluss, dass im wissenschaftlichen und medialen Diskurs über den Einsatz und die Regulierung von Gentechnik die Gesellschaft häufig auf reine Konsument*innen reduziert wird. Konsument*innen, so die häufige Erzählung, seien nur daran interessiert, ob ein Produkt für sie persönlich nützlich oder schädlich ist. Sie seien der Grund, warum es strenge Regulierungen brauche und müssten »aufgeklärt« werden, um dieses Hemmnis zu beseitigen.
Die Autor*innen der Studie nennen unter anderem zwei Gründe für diese unangemessene Reduzierung. Zum einen würden Verbraucher*innen fälschlicherweise als eine homogene Masse angenommen und ihre gesellschaftlichen Kontexte und Lebensumstände ignoriert. Zweitens würden die zuversichtlichen Perspektiven der Pflanzenentwickler*innen auf technologische Entwicklungen vorbehaltslos und ungeprüft übernommen. Laut Fischer und Kolleg*innen beruht dies auf »dem Wunsch …, zum gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen«. Zudem werde Fortschritt häufig mit technologischer Innovation gleichgesetzt und Expert*innenwissen in der Technologiebewertung meist bevorzugt.
All diese Untersuchungen zeigen, wie eine Perspektive – hier der Glaube an die objektive Expertise von Biotechnolog*innen – im gesellschaftlichen Diskurs verstärkt und damit die Einnahme anderer Perspektiven erschwert wird. Ivanov und Kolleg*innen haben in ihrem Artikel fünf Fragen formuliert, die Wissenschaftler*innen der biotechnologischen Saatgutentwicklung dazu ermutigen sollen, sich mit ihrer Arbeit, Regulierung und gesellschaftlicher Akzeptanz auseinanderzusetzen. Ziel ist es, eine differenzierte Sichtweise auf Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zu ermöglichen, die alle Beteiligten als wichtig und wissend anerkennt. Dies wiederum würde eine Sicht auf Regulierung als nützlichen Filter und Bestandteil jedes verantwortungsvollen Forschungs- und Innovationsprozesses begünstigen.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.






