- Politik
- Reichtum
Elon Musk: Der erste Billionär
Elon Musk ist der reichste Mann der Welt – und wird bald wohl viel reicher. Denn er lässt nicht nur die Börse für sich arbeiten

Tesla-Chef Elon Musk hat eine gigantische Prämie in Aussicht. In den nächsten Jahren winkt ihm ein Aktienpaket, dessen Wert bei Auszahlung fast eine Billion Dollar betragen könnte. Bedingung ist allerdings, dass der Elektroautohersteller unter seiner Führung festgesetzte Ziele erreicht. Gelingt das, so könnte Musk zur Belohnung bis zu 423,74 Millionen Tesla-Aktien bekommen, das entspricht bis zu zwölf Prozent der Unternehmensanteile. Angesichts der verhandelten Summe regt sich weltweit Kritik. Doch diese übersieht den eigentlichen Skandal an der Sache.
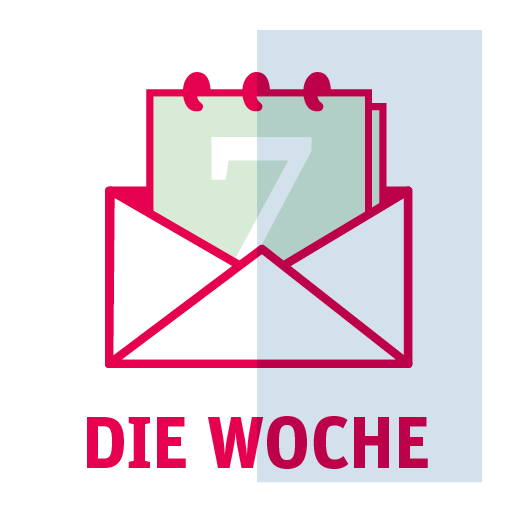
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Was Elon Musk hat
Bereits heute ist Musk der reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen beläuft sich auf rund 450 Milliarden Dollar. Wie bei reichen Menschen üblich, besteht sein Reichtum nicht aus einem großen Geldhaufen oder einem mit Gold gefüllten Speicher. Stattdessen handelt es sich um Anteile an Unternehmen, vor allem am Elektroautobauer Tesla, aber auch an SpaceX und xAI. Dieses Vermögen ist eine schwankungsanfällige Größe, was man auch daran erkennt, dass es vor zwei Monaten noch 70 Milliarden geringer war. Musks Vermögen steigt und fällt mit der Bewertung der Unternehmen beziehungsweise deren Aktien an der Börse. Das hat seinem Reichtum den Ruf eingebracht, bloß heiße Luft zu sein. Die ganze Wahrheit ist das nicht.
Der Aktienkurs Teslas, so heißt es, bildet »die Zukunft« ab, also die Erwartungen an das Unternehmen. Diese Erwartungen bilden sich am Markt, im spekulativen Hin und Her der Aktienhändler. Mal fällt die Aktie, mal steigt sie. Dennoch hat der Aktienkurs eine Grundlage, ein »Fundament«, mit dessen Hilfe an der Börse beurteilt wird, ob der Kurs tendenziell »übertrieben hoch« ist oder zu niedrig oder gerade richtig.
Wichtigste Kennzahl und Anker dieser »Fundamentalanalyse« ist das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV). Es setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum (erwarteten) Unternehmensgewinn pro Aktie. Ist beispielsweise der Gewinn der Gesellschaft 100 Euro und der Aktienkurs steht bei 1000, so beträgt das KGV 10. Anders gesagt: Die Aktiengesellschaft ist zum Zehnfachen des Jahresgewinns bewertet. Oder wieder anders: Wer alle Aktien des Unternehmens kauft, müsste – bei gleichbleibendem Gewinn – zehn Jahre warten, bis er die Kaufsumme wieder eingebracht hat.
Musk verkauft die kapitalistische Umsetzung von KI und Robotik als »tatsächlich das, was in einer kommunistischen Utopie mündet«.
-
Vor diesem Hintergrund ist einsichtig, warum die Tesla-Aktie mit einem KGV von über 220 als extrem hoch bewertet gilt – eben zum 220fachen des Jahresgewinns. Dies bedeutet, dass Tesla derzeit 220 Jahre Profit wert ist. Dass dieser schwindelerregende Wert nicht zum Kursabsturz führt, liegt allein daran, dass für die Zukunft gigantische Gewinnsteigerungen erwartet werden. Vielfach wird bezweifelt, ob diese im Aktienkurs vorweggenommenen Gewinnsteigerungen möglich sind – der Tesla-Aktienkurs gilt daher als irrational hoch. Doch zeigt diese Irrationalität nur die Rationalität des Systems, dessen Zweck der Unternehmensgewinn ist, also der Profit. An ihm, beziehungsweise am KGV, wird alles gemessen.
Grundlage der Spekulationen auf den Aktienmärkten ist also die gelungene Ausbeutung der Tesla-Arbeitskräfte beziehungsweise die Spekulation darauf. Die Tesla-Aktie, der Wert von Tesla und damit Musks Vermögen spiegeln damit nicht bloß Erwartungen der Märkte wider. In den Milliarden ist ein Anspruch formuliert, ein Anspruch an stark steigende Gewinne, die die Beschäftigten produzieren müssen. Dieser Anspruch muss eingelöst werden, andernfalls drohen Absturz und Kapitalentwertung.
Dass sich der Wert von Unternehmen aus den erwarteten Profiten der Zukunft errechnet, ist keine Spezialität verrückter Finanzmärkte, sondern im Kapitalismus üblich. Denn in ihm ist die Verwertung des Werts der ganze Zweck des Wirtschaftens und Arbeitens. Deswegen bemisst sich der Preis eines Unternehmens oder einer Fabrik danach, ob und inwiefern sie Mittel der Wertvermehrung sind. Das ist die logische Folge eines Systems, in dem alles Mittel des Profits ist und nur als solches zählt.
Was Elon Musk erreichen muss
Ob Musk sein riesiges Aktienpaket auch erhält, ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft: Zwölf »Meilensteine« muss Tesla unter seiner Führung in zehn Jahren dafür erreichen. Diese »Meilensteine« bestehen erstens in simplen Produktionszielen: So muss Tesla 20 Millionen Autos ausliefern, eine Million Robotaxis im Einsatz haben und eine Million Optimus-Industrieroboter ausgeliefert haben. Das ist zunächst eine solide Vorgabe. Daneben aber muss – das ist die zweite Bedingung – diese Produktion am Markt auch Gewinne bringen: Der Vorsteuergewinn muss schrittweise von zwölf Milliarden Dollar (2024) auf 50 und schließlich auf 400 Milliarden Dollar steigen.
Während Produktion und Auslieferung noch halbwegs kontrollierbar erscheinen, sind die Profitvorgaben schon mit vielen Unsicherheiten behaftet – insbesondere weil Tesla heftige Konkurrenz anderer Autobauer hat. Noch spekulativer wird die Liste der Ziele aber dadurch, dass von Musk als dritte Bedingung eine rasante Steigerung des Börsenwerts von Tesla verlangt wird. Derzeit hat Tesla bei einem Aktienkurs von 430 Dollar einen Börsenwert (Marktkapitalisierung) von 1,4 Billionen Dollar (das ist fast das 30-Fache von Volkswagen). Dieser Börsenwert soll nun bis auf 8,5 Billionen Dollar steigen. Musks Aufgabe ist es also nicht nur, ausreichend Autos zu produzieren, sondern mit ihnen auch hohe Gewinne einzufahren und gleichzeitig die Spekulation der Märkte auf weiter exorbitant steigende Gewinne zu nähren.
Ein Tesla-Großaktionär, der norwegische Staatsfonds, hatte sich gegen das geplantes Aktienpaket für Musk ausgesprochen. Man schätze zwar den erheblichen Mehrwert, den Musk mit seiner visionären Rolle geschaffen habe, teilte Norges Bank Investment Management (NBIM) vorab mit. Man habe jedoch Bedenken angesichts der beispiellosen Höhe der vorgeschlagenen Vergütung. Ausgedrückt ist in diesem Einwand keine Kritik an Musks obszönem Reichtum. Sondern Zweifel daran, ob seine Vergütung auch im Sinne des Unternehmens und seiner Aktionäre gerechtfertigt ist.
Was Elon Musk braucht
Der Reichtum der Superreichen wird vielfach kritisiert. Zum einen spielen dabei Gerechtigkeitserwägungen eine Rolle: Während die Beschäftigten mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen, wachsen die großen Vermögen immer weiter, so der Einwand. Dieser übersieht, dass die großen Vermögen die relative Armut derer, die ihn produzieren, zur Grundlage haben. Nur so entsteht der Profit, der an den Börsen spekulativ auf Jahre hochgerechnet wird.
Zum anderen wird kritisiert, dass der ökonomische Reichtum den Reichen auch politischen Einfluss sichere, was die Demokratie schädige. »Noch nie in der Geschichte hat eine kleine Gruppe von Menschen so viel Macht akkumuliert wie die Hyperreichen von heute«, schreibt Ute Scheub in den »Blättern für deutsche und internationale Politik« von »einer globalen Diktatur der Superreichen«. Das ist einerseits korrekt. Andererseits bleibt dabei außen vor, dass die ökonomische Macht der Reichen auf deren Macht über die gesellschaftliche Arbeit beruht – also über Arbeitsplätze, über die Menschen und ihre Arbeits- und damit Lebenszeit. Dies ist die »Materie« ihres Reichtums, ganz getrennt von dessen Größe. Die Macht des Eigentums über die Eigentumslosen. Hinter dem Werkstor endet die Demokratie schon immer.
Was Elon Musk verspricht
Ob Elon Musk sein Aktienpaket bekommt und welchen Wert es dann haben wird, hängt also nicht nur davon ab, ob er die Spekulation auf seinen Erfolg mit echten Profiten rechtfertigen kann. Sondern auch davon, ob er die Spekulation mit versprochenen Profiten weiter anfeuern kann. Er muss also etwas betreiben, was in den Führungsetagen von Aktiengesellschaften als »Erwartungsmanagement« bezeichnet wird und dort eine eigene Aufgabe darstellt: die Lenkung der Börsenspekulation durch Ankündigungen.
Das betreibt Musk mit großer Leidenschaft. Vergangene Woche kündigte er an, seine Optimus-Roboter würden »die Armut beseitigen«. Ein Optimus-Roboter, versprach Musk, werde die fünffache Produktivität eines Menschen pro Jahr erreichen, da er rund um die Uhr arbeiten könne. Gleichzeitig werde er die Produktivität der Menschen verzehn- oder verhundertfachen. Der KI seien keine Grenzen gesetzt. Arbeitsplätze werde es nicht mehr geben, sagte Musk, »arbeiten wird optional sein – wie das eigene Gemüse anzubauen, statt es im Laden zu kaufen«. Die kapitalistische Umsetzung von KI und Robotik – vorausgesetzt, sie verlaufe auf einem guten Weg – sei »tatsächlich das, was in einer kommunistischen Utopie mündet«.
Was er dabei vergaß zu erwähnen: Um diese Utopie zur Realität zu machen, wird es zwingend nötig sein, ihm und seinen Kollegen die Roboter abzunehmen, inklusive der Fabriken, Büros und der sonstigen Produktionsmittel. Das würde den Finanzmärkten zwar nicht gefallen. Aber die gibt es dann ohnehin nicht mehr.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.






