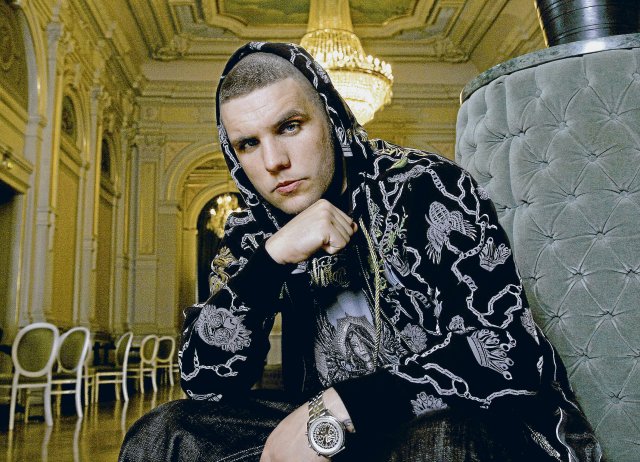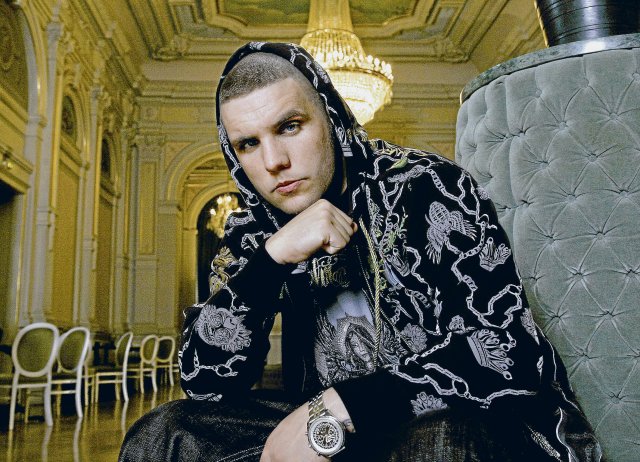- Kultur
- Nachruf
Hark Bohm: Ein linker Sozialpädagoge mit Kamera
Als Regisseur hat Hark Bohm einen Klassiker und viele sehr okaye Filme gemacht. Als Kulturpolitiker betrieb er Lobbyarbeit auf eher softe Weise.

Vor Kurzem kam der Film »Amrum« in die Kinos, den Hark Bohm eigentlich noch drehen wollte. Bohm hatte seine Kindheit am Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Nordseeinsel verbracht. Doch dann fehlte ihm die Kraft für eine ganze Filmproduktion. »Amrum« drehte dann sein Freund Fatih Akin. »Ein Hark-Bohm-Film von Fatih Akin«, heißt es zu Beginn. Am vergangenen Freitag ist der Filmemacher und Schauspieler Hark Bohm in seiner Geburtsstadt Hamburg gestorben, er wurde 86 Jahre alt.
Unter den 17 Filmen, bei denen er Regie führte, sticht einer heraus: »Nordsee ist Mordsee« von 1976 ist ein Klassiker. »Für mich immer noch der einzige Film, der widerspiegelt, wie unsere arbeiterliche Alleinerziehenden-Jugend in Hamburg ausgesehen hat«, erklärte mir Beate Schwartau, Jahrgang 1964, als ich sie in den Nullerjahren interviewte. Sie ist ein ehemaliges Heimkind, genau wie der Hauptdarsteller Uwe Bohm (1962–2022). Schwartau empfand den Film als »ganz einfach unverstellt«, für sie gab es damals »eben nichts Vergleichbares in anderen Filmen«: »Ich war auch immer ein Mädchen, das in Jungsbanden mitgemacht hat. In einer Szene in diesem Film ist so eine Göre, die einfach Kaugummi kaut und in dieser Missingsch-Sprache, dieser Regionalsprache, die wir da hatten, diesem Hamburger Slang, ihre knappen Fragen stellt. Auch die ist irgendwie mutig und hat keine Angst und alle sind irgendwie supercool.«
Vor »Nordsee ist Mordsee« hatte Bohm bereits zwei Spielfilme gedreht, die auf weniger Resonanz stießen: »Tschetan, der Indianerjunge« (1972) und »Ich kann auch ’ne Arche bauen« (1973). Der Erste wurde mit geringem Budget in den Wäldern in der Umgebung Münchens gedreht – dem damaligen Wohnort Bohms, wo er auch mit Natalja Bowakow zusammenkam, seiner zweiten Frau. Deren zehnjähriger Sohn Dschingis spielte die Hauptrolle. »Ich kann auch ’ne Arche bauen« ist ebenfalls ein Abenteuerfilm, diesmal über fünf Kinder. Bohm ging zum Casting in Kinderheime in Hamburg – er war mit der Familie in die Hansestadt zurückgezogen. Einer der Darsteller, die er dort auswählte, war der elfjährige Uwe Enkelmann, der dann zu Uwe Bohm wurde, als ihn Hark Bohm wie drei weitere Kinder adoptierte. Familie und Filme seien die beiden Fixsterne in seinem Leben, erklärte der Regisseur gern mit seinem leicht verschmitzten Gesichtsausdruck.
Für seine frühen Filme hat er Kindern und Jugendlichen gut zugehört und auch ihre Anregungen aufgenommen. Bei »Nordsee ist Mordsee« ließ er seinen jungen Darsteller*innen viel Raum für freies Spiel. Das Ergebnis ist großartig und ein Meilenstein im Genre der Coming-Of-Age-Filme. Neben Uwe Bohm spielt Dschingis Bowakow die Hauptrolle. Zuerst schikaniert Uwe mit seiner Jugendbande Dschingis (sie haben im Film dieselben Vornamen), es kommt zum Zweikampf und dann zur Versöhnung. Die beiden werden Freunde und träumen davon, aus dem proletarischen Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg auf einem Floß die Elbe hinunter bis zur Nordsee und weiter zu fahren. Den gewalttätigen Vater von Uwe spielte Marquard Bohm, der jüngere Bruder von Hark. Der Soundtrack stammt vom damals noch nicht so bekannten Udo Lindenberg. Der Film wurde ein Erfolg und Hark Bohm hatte nun einen Namen, was gut war für seine weiteren Projekte.
Durch Marquard war er überhaupt erst zum Film gekommen, als er in München Ende der 60er sein juristisches Referendariat antrat (und dann abbrach). Marquard hatte da schon mit verschiedenen alten wie jungen Regisseuren gedreht. Beide Brüder spielten dann 1969 in »Rote Sonne«, dem legendären Spielfilm von Rudolf Thome rund um eine WG von Frauen, die ihre Liebhaber umbringen. Marquard spielt die Hauptrolle und Hark einen linken Studenten. Anschließend spielte er in einigen Filmen von Rainer Werner Fassbinder, darunter »Händler der vier Jahreszeiten«, »Angst essen Seele auf« und »Die Ehe der Maria Braun«, mit. 1971 beteiligt sich Hark Bohm an der Gründung des selbstverwalteten Münchner Filmverlags der Autoren, um unabhängige Filmproduktionen finanziell absichern zu können.
Auch in Hamburg, wo er ab 1972 wieder wohnte, bemühte er sich zusammen mit anderen Filmemacher*innen um den Aufbau einer Filmförderung. 1979 gehörte er zu den Gründern des Hamburger Filmbüros und versäumte selten eine Versammlung dieser Selbstverwaltung der Filmszene. Dabei fand er in Hans-Ulrich Klose, dem Hamburger Bürgermeister vom linken Flügel der SPD, einen Kooperationspartner, wie er auch mit dessen Pressesprecher Manfred Bissinger und vielen anderen Kulturpolitiker*innen befreundet war.
Während die etablierte Kulturpolitik eher an der Förderung kommerzieller Filme interessiert war, bei denen eine Rückzahlung der Mittel fast ein Selbstläufer war, forderten auch weniger erfolgreiche Filmemacher für sozialkritische oder avantgardistische Produktionen Zuschüsse, ohne sich in ihre Arbeit hineinreden zu lassen. Hark Bohm wollte aber die Kulturpolitiker nicht zu harsch kritisieren und betrieb seine Lobbyarbeit eher auf softe Weise. Bei seinen eigenen Filmen achtete er zunehmend auf Marktgängigkeit, sie waren zwar gesellschaftskritisch, aber nicht zu radikal in Form und Inhalt, etwas gefällig und wenig kantig – aber gut gefördert, wie etwa 1978 »Moritz lieber Moritz«, der Nachfolgefilm von »Nordsee ist Mordsee«, oder 1984 »Der Fall Bachmeier – Keine Zeit für Tränen« über einen realen Fall von Selbstjustiz im Gerichtsaal, damals ein großes Thema für den Boulevard.
Als anerkannter Förderer der Filmszene in Hamburg und darüber hinaus hat Hark Bohm einiges erreichen können. Er beteiligte sich an der Initiierung des Hamburger Filmfestivals, baute den Studiengang Film an der Universität Hamburg mit auf und war 2003 Mitgründer der Deutschen Filmakademie, die den Filmpreis Lola verleiht. Er selbst erhielt 2018 die Ehren-Lola für seine herausragenden Verdienste um den deutschen Film.
In seinen letzten Lebensjahren fand Hark Bohm noch einmal zu einem großen Konflikt voller Spannungen: zu der Auseinandersetzung mit seinem Nazivater, dem Juristen und Hochschullehrer Walter Bohm, der bereits 1928 der NSDAP beigetreten war, 1933 auch der SA und der SS. Er wurde Hauptabteilungsleiter im Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und propagierte eine »Reinhaltung des arischen Blutes«. Nach dem Krieg setzte er seine Karriere fort und war als Hochschullehrer und Richter tätig. Hark Bohm wohnte nach seiner Rückkehr nach Hamburg wieder in der herrschaftlichen Villa seiner Eltern im großbürgerlichen Hamburger Stadtteil Othmarschen. Doch solange Hamburg im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten bombardiert wurde, lebte er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern auf Amrum.
Seine antifaschistische Kritik am Vater brachte Hark Bohm in seinen späten Jahren dazu, noch einmal ein Drehbuch zu schreiben, das er später mit einem Ko-Autor zu einem Roman verdichtete und aus dem dann der Spielfilm »Amrum« entstand. Die kritische Sicht auf den Vater, dessen nationalsozialistisch durchtränkte Blut-und-Boden-Bauerntümelei nichts mit der sozialen Lebensrealität der armen Bauern auf der kargen Nordseeinsel zu tun hat, ist der Kern des 2024 erschienenen Romans – und des ursprünglichen Drehbuchs, das aber leider von Fatih Akin, der die Verfilmung übernahm, verflacht und banalisiert wurde. Schön an der Verfilmung sind die Bilder – auch Hark Bohm selbst ist kurz zu sehen, wie er als alter Mann auf dem Kniepsand steht, dem großartigen Strand von Amrum, und auf das Meer schaut – und auf sein Leben zurückblickt, in dem er sich befreit hat vom Nationalsozialismus seines Vaters. Da war er schon fast ein »sialtööger«, wie ein Sterbender auf Amrumer Friesisch heißt.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.