- Kultur
- Kino
»Im Schatten des Orangenbaums«: Geste der Versöhnung
Die Regisseurin Cherien Dabis erzählt in »Im Schatten des Orangenbaums« die Geschichte einer palästinensischen Familie in drei Generationen

Es gibt Momente im Leben, da muss man sich entscheiden, ob man einer Ideologie folgen oder sich ganz einfach menschlich verhalten will. Doch in einer Atmosphäre des Hasses und des gegenseitigen Misstrauens scheint das fast unmöglich – in diesem Zirkel ist das Verhältnis von Israelis und Palästinensern seit Jahrzehnten gefangen. Alle Vermittlungsversuche werden von militanten Gruppen auf beiden Seiten immer wieder sabotiert.
Die amerikanisch-palästinensische Regisseurin Cherien Dabis erzählt in ihrer, an eigene Kindheitserfahrungen anknüpfenden Familiengeschichte über drei Generationen (von 1948 bis 2022) vom Schicksal der einzelnen Angehörigen. »Im Schatten des Orangenbaums« ist keine Agitation für oder gegen Israel, ihr Blick ist auf präzise Weise poetisch und stellt die Biografien der Einzelnen ins Zentrum des Films. Sie berichtet, aber verurteilt nicht.
Der Film ist keine Agitation für oder gegen Israel. Der Blick ist auf präzise Weise poetisch und stellt die Biografien der Einzelnen ins Zentrum.
Der Unfriede zwischen Palästinensern und Israelis dauert nun schon über achtzig Jahre. Bereits als Palästina noch britisches Mandatsgebiet war, polarisierte der Zionismus. Das Programm der Judenvernichtung der NS-Diktatur hatte Millionen Menschen das Leben gekostet. Sollten die den Holocaust überlebenden Juden nicht einen eigenen Staat bekommen, der ihnen Sicherheit bieten konnte? Bereits lange vor 1945 hatte die zionistische Siedlungsbewegung in Palästina zahlreiche Gebiete in dem damals dünn besiedelten Land aufgekauft. Könnten diese nicht zur Keimzelle eines neuen Staates werden? In der Theorie lag das nahe, in der Praxis aber wurde es kompliziert, denn auch in den dünn besiedelten Gegenden lebten Menschen, die ihren Grund und Boden nicht hergeben wollten.
Nicht wenige deutsche Kommunisten jüdischer Herkunft kamen als Exilanten nach Palästina: von Arnold Zweig über Louis Fürnberg, Hans und Lea Grundig bis zu Rudolf Hirsch, später »Wochenpost«-Gerichtsreporter und Autor des Buches »Der gelbe Fleck« über die Geschichte des Antisemitismus. Der Zionismus war unter ihnen umstritten. Arnold Zweig etwa gab in Haifa die deutschsprachige Zeitschrift »Der Orient« heraus, mit links-liberaler Ausrichtung. Die zionistisch-nationalistische Untergrundbewegung Hagana verübte einen Sprengstoffanschlag auf die Redaktion der missliebigen Zeitschrift, die daraufhin nicht mehr erscheinen konnte. Da wurde nicht zuletzt Zweig selbst klar, dass hier ein grundsätzlicher Richtungsstreit im Gange war, die Politik des zu gründenden Staates Israel betreffend. Der Schriftsteller kam 1948 nach Ost-Berlin.
Die Staatsgründung Israels steht im Hintergrund von »Im Schatten des Orangenbaums«. Es ist die Geschichte der Vertreibung der Großeltern aus Jaffa im Westjordanland, wo die Familie Orangen anbaute und in die ganze Welt verkaufte. Vor allem für den Großvater ist diese Vertreibung eine Tragödie, über die er nie hinwegkommt. Ein Teil der Familie geht nach Jordanien, andere bleiben im Westjordanland und versuchen, sich mit Israel zu arrangieren – mit wechselndem Erfolg.
Da der Film die Geschichte aus rein palästinensischer Sicht erzählt, von ständiger Gewaltandrohung und Demütigung berichtet (Ausgangssperren und Militärkontrollen), kommt der palästinensische Terror, den es auch immer gab, hier nicht vor. Man könnte die Einseitigkeit der Darstellung monieren, wenn es nicht unterhalb dieser Betrachtungsebene des israelisch-palästinensischen Konflikts um den beschwerlichen Alltag von drei Generationen einer palästinensischen Familie ginge.
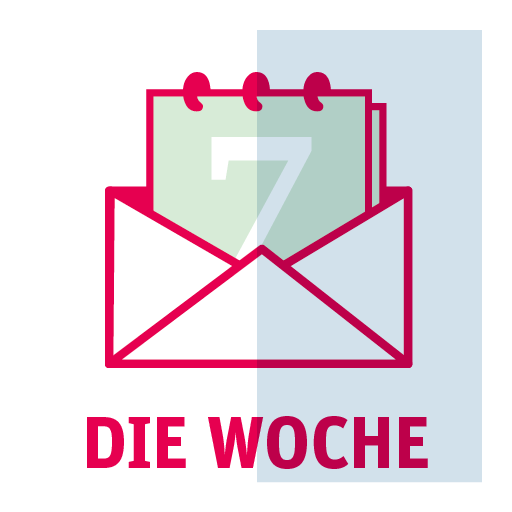
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Diese Familie stellt uns Cherien Dabis vor – und übernimmt selbst darin eine der Hauptrollen. Die im palästinensischen Theater und Film bekannten Saleh Bakri, Adam Bakri und Mohammed Bakri spielen die Männer der Familie – und das überaus stark in sich zurückgenommen, geradezu introvertiert. Der Großvater und der Vater leiden sehr unter den Zuständen, hoffen aber auf eine Besserung mit der Zeit, setzen auf Vernunft und Diplomatie – und wollen keinerlei gewaltsame Konfrontation mit den Israelis.
Doch der Enkel Noor (Muhammad Abed Elrahman) glaubt nicht mehr an solch eine Verbesserung. Er fühlt sich als Rächer der gedemütigten Familie, schließt sich radikalen Gruppen an – und wird 1988 bei einem Zusammenstoß mit israelischen Soldaten durch einen Schuss schwer am Kopf verletzt. Er ist nicht mehr zu retten, und die Eltern stehen, als sein Hirntod in einem israelischen Krankenhaus festgestellt wird, vor der Entscheidung, ob sie die Organe des Jungen zur Transplantation freigeben sollen. Unser Sohn, der von israelischen Soldaten erschossen wurde, soll nun andere israelische Jungen retten? Und was, wenn unter ihnen wieder ein Soldat ist, der auf Palästinenser schießt?
Die Eltern sind wie gelähmt, wissen nicht, was sie tun sollen. Ihr toter Sohn könnte anderen jungen Menschen ein Weiterleben ermöglichen. Das sollte ein Trost sein, wenn diese anderen nicht ihre Feinde, die Israelis, wären. Die Entscheidung fällt ihnen schwer. Aber Menschen sind Menschen. Sollte nicht das allein zählen? Was aus ihnen einmal wird, wie sie sich verhalten werden, weiß niemand – aber wenn man ihnen das Wertvollste schenkt, was man noch besitzt, gibt man ihnen nicht auch etwas mit auf den Lebensweg, was das Humane in ihnen wachhält? Diese Hoffnung haben sie.
Noch einmal Jahrzehnte später begleiten wir die nun alt gewordenen Eltern auf einer Reise nach Jaffa, ihrem Heimatort. Sie reisen auf den Spuren der durch die Organspenden geretteten Jungen, die inzwischen Männer geworden sind. Ist diese Begegnung nun eine Bestätigung für ihren Entschluss damals?
Der Terroranschlag der Hamas auf ein israelisches Musikfestival vom 7. Oktober 2023 forcierte die Gewaltspirale. Wie soll man das jemals wieder befrieden? Der Anschlag traf die Regisseurin mitten in der Vorbereitung zu den Dreharbeiten, die vor allem in Jordanien stattfanden. Sollte sie den Film aufgeben? Nein, das wollte sie nicht, wie sie im Interview zu ihrem eindrucksvoll persönlichen und ganz und gar nicht ideologischen Film sagt: »Wir lernen Geschichte aus einer bestimmten Perspektive. Wir müssen uns fragen, ob wir inhärente Vorurteile haben. Wir müssen uns fragen, ob wir uns in die Lage des anderen versetzt haben. Wir müssen uns fragen, ob wir neugierig sind zu erfahren und zu verstehen, was der andere erlitten hat. Das ist eine Aufgabe, der wir uns alle stellen sollten.« Versöhnung, so erfahren wir hier, muss immer beim Einzelnen beginnen, beim Verzicht auf Vergeltung für erfahrenes Unrecht. Aber erinnern muss man es.
»Im Schatten des Orangenbaums«: Deutschland, Zypern, Jordanien. Regie und Drehbuch: Cherien Dabis. Mit: Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri. 145 Minuten, Start: 20. November
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.






