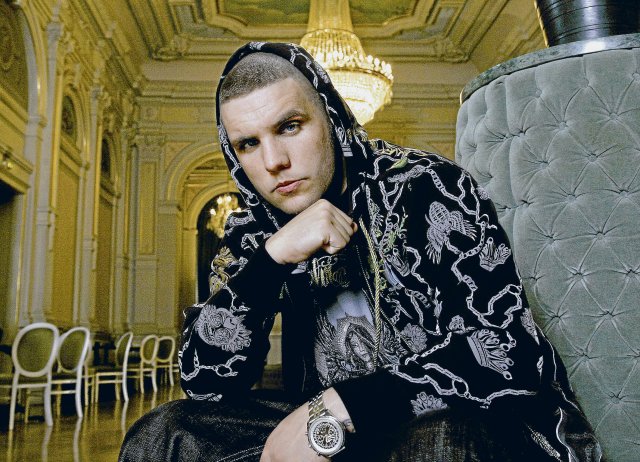- Kultur
- 125. Geburtstag
Anna Seghers: Die Tragik eiserner Disziplin
Zum 125. Geburtstag der Schriftstellerin und Antifaschistin Anna Seghers

Sie wollen alle nur eines: Dem drohenden Tod in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager entkommen. Etwa 350 Menschen drängen sich an Bord des französischen Frachters »Capitaine Paul Lemerle«, der am 24. März 1941 den Hafen von Marseille verlässt. Das Schiff verfügt über zwei Kabinen und sieben Schlafplätze. Also werden die Geflüchteten in die kalten Frachträume eingepfercht, ohne natürliches Licht. Und doch haben sie Glück: Sie besitzen ein lebensrettendes Visum, während 200 000 andere Geflüchtete in Marseille noch um solche Papiere kämpfen.
Marseille liegt in dem Teil Frankreichs, der damals noch nicht von deutschen Truppen besetzt ist. Aber das Vichy-Regime, das hier das Sagen hat, liefert Menschen an die Deutschen aus. An Bord der »Capitaine Paul Lemerle« hat sich auch die deutsche Schriftstellerin Anna Seghers gerettet, Jüdin und Kommunistin, begleitet von ihrem 14-jährigen Sohn Peter und ihrer zwölfjährigen Tochter Ruth. Das Schiff beginnt eine monatelange Irrfahrt in die Karibik, die über Martinique und die Dominikanische Republik führen wird. Im Chaos bringt Seghers täglich Notizen zu Papier. Sie will alles festhalten für einen Roman. Er wird 1944 erscheinen und den Namen »Transit« tragen. Da wird die Autorin schon drei Jahre im mexikanischen Exil sein – und weltberühmt.
Mit Selbstdisziplin überlebt die Antifaschistin. Diese eiserne Disziplin ist ein zentrales Motiv ihres Lebens – und wird sie später in der Deutschen Demokratischen Republik zu einer gefeierten Repräsentantin des Staates, aber auch zu einer tragischen Figur machen.
Was bleibt, ist ihr Vermächtnis als Antifaschistin, sind ihre beeindruckenden Romane und Erzählungen.
Hat ihr Kampf, hat ihr Schreiben den Menschen heute noch etwas zu sagen? Dies wollte die Rosa-Luxemburg-Stiftung wissen, ging das Wagnis einer Veranstaltungsreihe – und wird belohnt. Allein zum Auftaktabend in Frankfurt am Main im Oktober kamen fast 300 Menschen in das Haus am Dom, auch drei weitere Termine in Mainz und in Berlin wurden rege besucht. Die mexikanische Übersetzerin Claudia Cabrera, die viele Seghers-Werke des Exils ins mexikanische Spanisch übertragen hat, ist eigens aus Mexiko angereist. Die Exil-Zeit der Schriftstellerin in Mexiko beginnt mit der Ankunft der »Capitaine Paul Lemerle« in der Hafenstadt Veracruz am 30. Juni 1941.
Der Lebensweg von Anna Seghers nahm seinen Anfang am 19. November 1900 in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz – da wird Annette Reiling geboren, Tochter eines Kunst- und Antiquitätenhändlers, einziges Kind einer bürgerlichen jüdischen Familie. Schon vor dem Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und Sinologie in Köln hat sie angefangen zu schreiben. Dieses Schreiben gerät zu einem zweiten, bestimmenden Element ihres Lebens.
Ihre Promotion beschäftigt sich mit »Juden und Judentum im Werk Rembrandts«. Und als sie ein Pseudonym sucht, unter dem sie als Schriftstellerin arbeiten kann, stößt sie auf Hercules Seghers, einen mit Rembrandt befreundeten Maler, und nimmt seinen Nachnamen an. Die Bürgertochter radikalisiert sich, heiratet 1925 den Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen László Radványi, der Mitglied der KPD ist. Wie viele junge Menschen folgt das Ehepaar dem Lockruf Berlins. Seghers schließt sich 1928 der Kommunistischen Partei an. Und arbeitet zugleich entschlossen an ihrer Entwicklung als Schriftstellerin.
Schon ihr erstes Buch, »Aufstand der Fischer von Santa Barbara«, setzt 1928 ein Thema, das sie lebenslang nicht loslassen wird. Die Fischer eines fiktiven Küstenortes kämpfen für höhere Löhne, ein besseres Leben – sie scheitern, doch der Freiheitswille bleibt. Die Novelle erhält den renommierten Kleist-Preis, der Name der Autorin wird bekannt. Auch den Nationalsozialisten, die fortan die Kommunistin im Visier haben.
Seghers zögert denn auch nicht, als die Nazis Anfang 1933 an die Macht kommen, Deutschland zu verlassen. Sie flieht erst in die Schweiz, dann in die französische Hauptstadt Paris. Aber die Autorin wird immer schreiben, auch unter widrigsten Umständen. Ihre Übersetzerin Claudia Cabrera sagt: »Ohne das Schreiben wäre sie gestorben.« Helga Neumann vom Literaturarchiv der Akademie der Künste in Berlin, die das Erbe von Seghers betreut, hebt einen Roman hervor, der im französischen Exil entsteht: »Die Rettung« von 1937. Die Geschichte eines Bergmanns, der im oberschlesischen Kohlerevier ein Grubenunglück überlebt und sich dem Kampf der Kommunisten im Untergrund gegen die Nazi-Herrschaft anschließt.
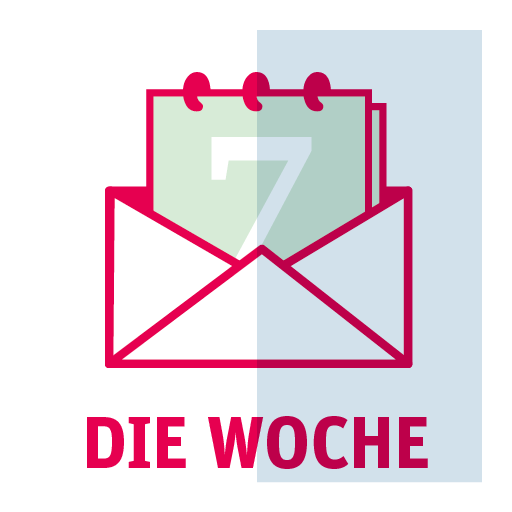
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Als die deutsche Wehrmacht am 14. Juni 1940 in Paris einmarschiert, ist die Schriftstellerin mit Hunderttausenden anderer wieder auf der Flucht, in den französischen Süden. Mit einem Visum des mexikanischen Generalkonsuls Gilberto Bosques in Marseille gelangen sie und ihre Kinder an Bord der »Capitaine Paul Lemerle« und nach Mexiko. Die linke Regierung Mexikos mit Präsident Lazaro Cardenas an der Spitze gewährt gezielt Kämpfern gegen den Faschismus Asyl. Am 12. Juli 1941, wenige Tage nach ihrer Ankunft, schreibt sie an ihren Freund, den Verleger Wieland Herzfelde, an dessen Exil-Adresse in New York: »Soweit ich hier schon was vom Leben gerochen habe, gefällt es mir sehr. Ich glaube, ich fühle mich hier fast besser als in New York. Ich werde hier gut arbeiten können.«
Viele deutsche Freunde trifft sie in Mexiko: Zum Beispiel die Schriftsteller Egon Erwin Kisch, Gustav Regler und Ludwig Renn oder die Schauspielerin Steffi Spira. Gerade 1941 erscheint vielen Exilanten die Lage hoffnungslos: Die deutsche Wehrmacht erobert den Balkan und Griechenland, marschiert in Russland Richtung Moskau. Manche deutsche Geflüchtete begehen aus Verzweiflung Selbstmord. Seghers dagegen stürzt sich in Mexiko in die Arbeit. Gründet mit anderen zusammen die Monatszeitschrift »Bewegung Freies Deutschland« und den »Heinrich Heine-Klub«. Ihre Übersetzerin Claudia Cabrera verweist auch auf Seghers als Mutter: Sie habe sich aus Verantwortung für ihre Kinder keine Schwäche gestattet.
1942 eine entscheidende Wende. Sie veröffentlicht, zunächst in englischer Sprache, den Roman, der sie berühmt macht: »Das siebte Kreuz«. Die Geschichte des KZ-Gefangenen Georg Heisler, der erfolgreich dem Konzentrationslager entkommt. Als das Werk 1944 in den USA von dem österreichischen Emigranten Fred Zinnemann verfilmt wird – mit dem Star Spencer Tracy in der Hauptrolle – sieht ein Millionenpublikum den Film. Natürlich glättet Hollywood die Romanvorlage stark – so wird zum Beispiel unterschlagen, dass Heisler Kommunist ist. Aber die Emigrantin Seghers erhält in Mexiko die unglaubliche Honorar-Summe von 75 000 Dollar – und kann damit ihre Familie und andere Geflüchtete über Wasser halten.
Dafür gibt es böse Rückschläge, die ihr Leben überschatten. Sie erhält die Nachricht, dass ihre Mutter in einem deutschen Lager gestorben ist. Am 24. Juni 1943 abends wird Seghers auf einer Hauptstraße von Mexiko City von einem Lastwagen überfahren und lebensgefährlich verletzt. Der Lenker begeht Fahrerflucht. Emigranten halten ein Attentat von Nazi-Agenten für möglich. Die Sache wird nie aufgeklärt. Die gesundheitlichen Folgen bleiben Seghers für ihr restliches Leben.
Typisch ist, dass sie alles schreibend verarbeitet: in der Novelle »Ausflug der toten Mädchen«, die 1946 erscheint. Darin geht sie dem Schicksal ihrer ehemaligen Schulfreundinnen aus Mainz nach. Keine der Frauen überlebt, gleich ob Widerstandskämpferin oder überzeugte Nationalsozialistin.
Obwohl sie Mexiko liebt, die Natur, das Klima, die Kunst, drängt es die Schriftstellerin nach Deutschland zurück. Sie hofft, wie andere mexikanische Emigranten, beim Aufbau eines demokratischen, sozialistischen Staates eine Rolle zu spielen. Doch als sie am 22. April 1947 in Ost-Berlin eintrifft, kommt Seghers viel zu spät: Die politischen Aufgaben in der künftigen DDR sind längst verteilt. Die Führungspositionen besetzen die Mitglieder der Gruppe um Walter Ulbricht, die aus dem Exil in der UdSSR schon 1945 zurückgekehrt sind.
Die Hoffnung auf eine sozialistische Demokratie erfüllt sich nicht. Obwohl Seghers bitter enttäuscht vom Leben in der DDR ist, protestiert sie öffentlich nicht. Sie ordnet sich, wieder mit eiserner Disziplin, der politischen Linie der Partei unter. Claudia Cabrera geht so weit zu sagen: »Sie war die Linie.« Aus Sicht von Cabrera eine tragische Entwicklung. Seghers wird gleichsam mit der Position der Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes »abgefunden«, die sie von 1952 bis 1978 bekleidet. Als 1956 Walter Janka, ihr Kampfgefährte aus dem mexikanischen Exil, in der DDR wegen konterrevolutionärer Umtriebe angeklagt wird, hilft sie ihm öffentlich nicht. Janka hatte unter anderem freie Wahlen gefordert. Sie lässt zu, dass er zu fünf Jahren Einzelhaft verurteilt wird.
Auch bei der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976 bleibt Seghers eisern auf Linie der Parteiführung. Während zahlreiche Intellektuelle und Schriftsteller eine Petition für die Rückkehr Biermanns unterzeichnen, hält sich Seghers vom Protest fern. Den Zusammenbruch der DDR erlebt sie nicht mehr, sie stirbt schwer krank am 1. Juni 1983. Was bleibt, ist ihr Vermächtnis als Antifaschistin. Und es bleiben neun Romane und mehr als sechzig Erzählungen.
Von Claus-Jürgen Göpfert, langjährigem Redakteur der »Frankfurter Rundschau«, erscheint eine ausführliche Würdigung Anna Seghers’ im Dezember-Heft der Zeitschrift »Sozialismus«. Überblick zu Veranstaltungen zum 125. Jahrestag unter
https://anna-seghers.de/aktuelles
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.