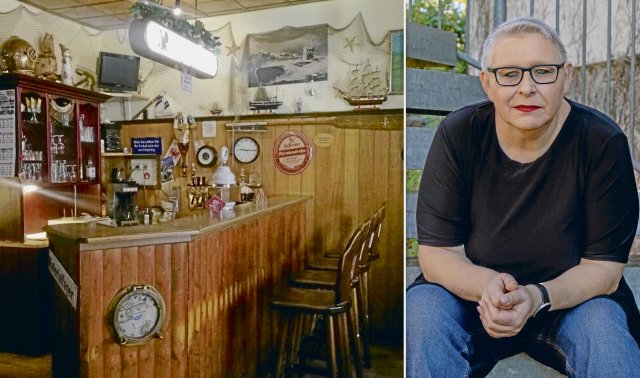- Berlin
- Gesundheit
Kriegsszenarien für die Krankenhäuser
Frieden ist die beste Medizin, sagen die Ärzte gegen den Atomkrieg

Es würde wahrscheinlich zunächst eine Schockstarre auslösen, wenn die Warn-App auf dem Mobiltelefon anzeigt, dass der Nato-Bündnisfall ausgerufen wurde, meint Andrè Solarek, Leiter der Stabsstelle Resilienz, Krisenmanagement und Katastrophenschutz an der Berliner Universitätsklinik Charité. Woher »diese Bauchschmerzen« kommen könnten, ob es vielleicht an »zu wenig Information« oder »einer wenig guten Vorbereitung« liege, darüber wollte er am Donnerstag beim 24. Berliner Rettungsdienstsymposium im Audimax am zur Charité gehörenden Virchow-Klinikum reden.
Ein Bundeswehroberst hätte dort zuvor über den »Operationsplan Deutschland« sprechen sollen, musste aber wegen Terminproblemen absagen – und der Operationsplan ist eigentlich geheim. »Wir werden mit Informationshäppchen abgespeist«, kritisierten Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen der Hauptstadt bei einer Protestaktion vor dem Eingang.
Bekannt ist dagegen der Inhalt des »Rahmenplans für die zivile Verteidigung im Bereich der Berliner Krankenhäuser«. Den hat die Senatsgesundheitsverwaltung gemeinsam mit der Bundeswehr, der Krankenhausgesellschaft und den Betreibern von zwölf ausgewählten Kliniken der Hauptstadt erstellt. Der Rahmenplan enthält sechs Szenarien – vom erhöhten Patientenaufkommen bei funktionierender Infrastruktur bis zur kriegerischen Auseinandersetzung in Berlin selbst und zur vollständigen Evakuierung der Hauptstadt. Die letzten beiden Szenarien werden als »nicht realistisch« eingestuft, müssten aber berücksichtigt werden, heißt es.
Der Verein demokratischer Ärzt*innen kritisiert an dem Plan vor allem »die Erwägung von sogenannter umgekehrter Triage«, bei der geringfügig verletztes militärisches Personal, das schnell wieder einsatzfähig werden kann, Vorrang vor Schwerverletzten und Zivilpersonen bekäme. Letzteres wird als »offene und sehr komplexe Fragestellung« bezeichnet, während die Genfer Konventionen zum Schutz von Zivilpersonen und die Regularien des Weltärztebundes so etwas ausschließen.
Mit bis 1000 Verletzten pro Tag, die auf deutsche Krankenhäuser verteilt werden müssen, rechnet die Bundeswehr im Kriegsfall. Zwar gibt es mehr als 1800 Kliniken in Deutschland, aber zum Beispiel nur 170 Betten für schwere Verbrennungen, wie Dr. Angelika Wilmen in einem Redebeitrag bei der Protestaktion des Berliner Bündnisses »Gesundheit statt Profite« betonte.
Patienten mit schwersten Verbrennungen müssen meist mehrere Wochen oder Monate im Krankenhaus behandelt werden – während möglicherweise jeden Tag weitere Kriegsverletzte hinzukommen. »Wir werden euch nicht helfen können« lautet der Titel einer Broschüre des Vereins demokratischer Ärzt*innen gegen die Militarisierung des Gesundheitswesens.
Die Möglichkeit der Eskalation bis zum Einsatz von Nuklearwaffen werde in fast allen Papieren zum Zivilschutz weitgehend ausgeblendet, sagte Wilmen, die sich seit vielen Jahren bei den Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) engagiert, am Donnerstag. Die Hiroshima-Bombe habe schätzungsweise allein rund 60 000 Verbrennungsopfer gefordert.
Mit der Medizinstudentin Stella Ziegler stellte Wilmen zudem eine Erklärung der IPPNW für ein ziviles Gesundheitswesen vor, zu der sich alle Beschäftigten aus Gesundheitsberufen öffentlich bekennen könnten. »Die Prävention von Kriegen, ob konventionell oder nuklear, ist die beste Medizin«, heißt es darin. Jede Schulung oder Fortbildung in Kriegsmedizin sowie deren Vorrang vor der zivilen medizinischen Versorgung wird abgelehnt. »Das ändert nichts an meiner Verpflichtung und Bereitschaft, in allen Notfällen medizinischer Art meine Hilfe zur Verfügung zu stellen und auch weiterhin meine Kenntnisse in der Notfallmedizin zu verbessern«, verlas Ziegler bei der Protestaktion aus der Erklärung.
Auch im Audimax wurden Bedenken gegen die teils unausgereiften Konzepte der zivil-militärischen Zusammenarbeit geäußert. »Wir sind ja, wenn wir ehrlich sind, für den Normalfall noch nicht mal richtig aufgestellt«, erklärte eine Teilnehmerin aus dem Publikum, in dem zahlreiche Rettungs- und Pflegefachkräfte saßen, die größtenteils applaudierten. Wie denn die Finanzierung laufen solle, wollte sie wissen. »Das kostet ja alles Geld.«
Adrian Flores von der Senatsverwaltung konnte da »zumindest mitfühlen« und meinte in Abwesenheit derjenigen, die über die Finanzen entscheiden: »Wir sind gleichermaßen auch die Leidtragenden.« Auch 600 Millionen Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität seien für die Krankenhäuser angesichts der aktuellen Lage nur »begrenzte Mittel«.
Vor dem Block »Zivile Verteidigung« waren bei dem Symposium bereits überlastete Notaufnahmen und fehlende Anlaufstellen für kranke Obdachlose Thema. »Wir wissen ja alle, dass Obdachlose und psychisch Kranke im Grunde verloren sind«, hatte Oberarzt Götz Möhl vom Rettungsdienst des Bundeswehrkrankenhauses in der Podiumsdiskussion gesagt. »Das ist ja teilweise wie in Manila hier.«
Jessica Frömmer, Pflegedienstleiterin der Zentralen Notaufnahme der Charité, berichtete von schwerbehinderten Obdachlosen, deren Rollstühle bei der Einlieferung nicht mitgenommen werden konnten. Bei deren Entlassung würden Kollegen zum Teil schon darüber nachdenken, privat einen Rollstuhl anzuschaffen. Eine menschenwürdige Standardlösung gibt es demnach nicht.
Im Kriegsfall, so Charité-Krisenmanager Solarek, werde man zudem »Patienten haben, die mit Keimen besiedelt sind, die wir hier in Europa gar nicht kennen und mit denen wir auch nur sehr schwer umgehen können«. Zu »Spitzenzeiten« müsse man dann »vielleicht auch mal Dienstzeiten anpassen« und brauche dafür die Unterstützung der Personalräte.
»Die komplette Führungsmentalität in den Krankenhäusern wird sich ändern, wenn wir in diese Situation rutschen«, betonte Solarek. Zudem erwähnte er den »Aufbau von resoluten Sicherheitsdiensten« für die Kliniken. »Wir müssen uns vielleicht auch damit anfreunden, dass es zu einer erhöhten Polizei- und Militärpräsenz im öffentlichen Raum kommen wird«, sagte Solarek. Beschäftigte, die im Normalfall mit dem Auto zur Arbeit kommen, könnten sich überlegen, ob sie Treibstoffvorräte anlegen, regte er an. Direkt empfehlen oder gar vorschreiben wollte Solarek dies aber nicht. Ein anwesender Feuerwehrmann fand die Idee auch nicht so gut. Ein Pfleger warf die Frage auf, ob die zahlreichen Pflegefachkräfte mit Migrationshintergrund bei Ausbruch eines Krieges nicht lieber zu ihren Familien im Ausland zurückkehren würden.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.