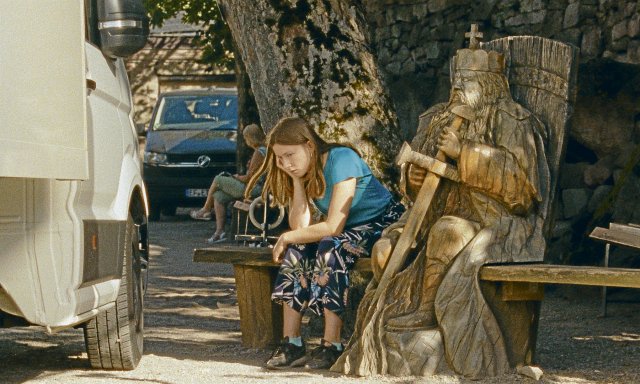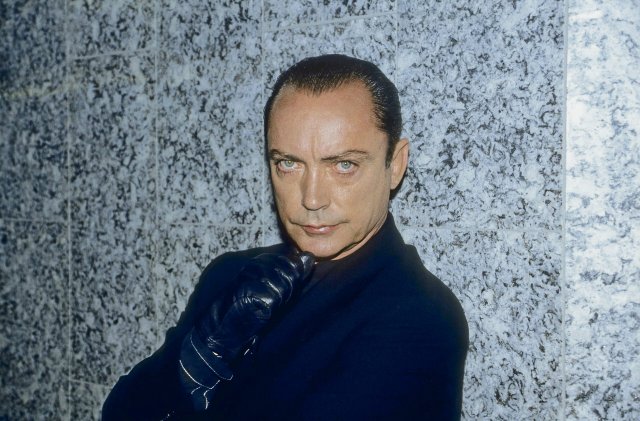- Kultur
- Christian Stache
Zurück zu Öko-Lenin
Gegen die Schwächen ökosozialistischer Ansätze empfiehlt Christian Stache einen Öko-Leninismus

Die ökologische Frage ist die zentrale soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Sie ist zugleich eine Klassenfrage, den Ursachen und Folgen nach, die Millionen von Menschen, vor allem Lohnabhängigen, Bäuer*innen und Slumbevölkerung im globalen Süden das Leben kosten wird. Zwar gibt es ökosozialistische Positionen, die diesen Zusammenhang begreifen. Aber diese sind randständig, selbst innerhalb jener marginalen Linken, die den Kapitalismus überwinden will. Über die Konstellation dieser Ansätze hat sich der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Christian Stache nun einen Überblick verschafft. In seinem neuen Buch »System Update oder System Change?« über »Glanz und Elend des Ökosozialismus«, wie es im Untertitel heißt, geht er mit dessen Positionen hart ins Gericht.
Ein Unding namens Marktsozialismus
Stache kennt sich aus, er hat mehrere Aufsätze zum Ökomarxismus veröffentlicht, dazu 2017 das Buch »Kapitalismus und Naturzerstörung. Zur kritischen Theorie des gesellschaftlichen Naturverhältnisses«. Er spricht angesichts der ökologischen Krise von Überlebensfragen, bei denen uns die Zeit davonlaufe. »Wer von der Ökologie nicht reden will, sollte von Sozialismus und Kommunismus schweigen«, schreibt er in Abwandlung von Max Horkheimers Bemerkung über den Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus. Lobenswert ist, weil auch unter Ökomarxist*innen selten, dass Stache die Tiere einbezieht, die zwar nicht Subjekt, aber Objekt der Befreiung sein müssten, wie er notiert.
Aus der Vielzahl ökosozialistischer Ansätze hat der Autor sechs Idealtypen destilliert, die er anhand von fünf Leitfragen analysiert: Was sehen sie als Ursache der Naturzerstörung? Wen machen sie dafür verantwortlich? Welche Alternative schlagen sie vor? Wer wäre ihr potenzieller Träger und wie sieht ihre Strategie aus? Seine Kritik ist pointiert, größtenteils zutreffend und macht das Buch zur lohnenden Lektüre trotz einiger Schwächen zum Ende hin.
Stache beginnt seine Typisierung mit der bewegungsorientiert-linkssozialdemokratischen Fraktion, wie er sie nennt, die für einen Green New Deal steht. Als deren Vertreter nennt er Bernd Riexinger und Raul Zelik von der Linkspartei. Diese würden von Monopol, Rente, Landnahme, ungleichem Tausch oder außerökonomischem Zwang sprechen, womit die Ausbeutung von Lohnabhängigen im Produktionsprozess in den Hintergrund trete. Dagegen betont Stache, die meisten klimarelevanten Gase würden »in der Produktion und nicht bei der Erschließung von Natur« erzeugt. Die verfehlte Analyse dieses Ökokeynesianismus stütze eine Politik, die kommunistische Parteien früher antimonopolistisches Bündnis mit Teilen der Bourgeoisie nannten. Das Ergebnis sei ein Unding, ein Marktsozialismus. Eigentumsverhältnisse und Warenproduktion werden nicht in Frage gestellt, rügt Stache. Hilfreich wäre gewesen, wenn Stache betont hätte, dass ein Green New Deal, der dem Kapital Profite und den Lohnabhängigen gut bezahlte Jobs verspricht, auch deshalb gar nicht umweltschonend sein kann, weil Wachstum die Voraussetzung ist.
Wert- und Konsumkritik
Die zweite Strömung bezeichnet Stache als zirkulationstheoretisch-strukturalistisch, gemeint sind Werttheoretiker in der Nachfolge von Robert Kurz, wobei er sich insbesondere den Publizisten Tomasz Konicz vornimmt. Aus der technischen Entwicklung leite diese Richtung ab, dass Maschinen die Arbeiter ersetzen würden, folglich kein Mehrwert mehr entstehe und der Kapitalismus implodiere. Stache hält ihnen vor, die Klassenfrage über Bord geworfen zu haben, kein revolutionäres Subjekt zu nennen, weshalb Konicz für breite Bündnisse plädiere und aus taktischen Gründen Reformismus unterstütze.
Wohlwollend behandelt Stache die Tradition kritischer Theorie. Er setzt sich hier mit dem Philosophen Ulrich Ruschig auseinander, den er dieser Richtung zuordnet. Dessen Buch »Wie kapitalistische Herrschaft die lebendige Natur ruiniert« ist unlängst ebenfalls im Papyrossa-Verlag erschienen. Dabei würdigt er, dass Ruschig die Überausbeutung der Tiere thematisiert. Allerdings wirft Stache der kritischen Theorie insgesamt vor, keinen Begriff »für das Individuelle und Qualitative bei Tieren« zu haben. Stache schreibt, heute sei anders als zu Herbert Marcuses Zeiten Veganismus möglich, die Technik dafür vorhanden.
Stache gehört zu jener Linken, die ausblendet, dass jeder kapitalistische Staat, der dazu in der Lage ist, imperialistische Politik betreibt.
Damit geht es dann auch bei Stache um Konsum, was bemerkenswert ist, weil er in der Einleitung der ökosozialistischen Linken pauschal vorwirft, den Stellenwert des Konsums zu überschätzen. Er hat durchaus recht mit der Feststellung, dass das Kapital den Konsum nach seinem Bedürfnis gestaltet, maximal Waren zu verkaufen. Dabei gerät Stache aus dem Blick, dass dieses Interesse des Kapitals wichtige Effekte zeitigt: Positiv ist, dass die Produktivität so gesteigert wurde, dass die Menschheit potenziell ausreichend Nahrung, medizinische Versorgung, Kleidung, Heizung, aber auch praktische Dinge wie Kühlschrank und Waschmaschine haben könnte. Ökologisch negativ zu Buche schlägt der Schnickschnack, der in die Kategorien Statussymbole und Kompensation für entgangenes Lebensglück fällt, während die Vorstellung, darauf verzichten zu müssen, Ängste und Hass auslöst, den die extreme Rechte mit Erfolg bewirtschaftet. Insofern macht Stache es sich für einen Marxisten zu leicht, denn der Konsum ist ein zentrales Moment der materiellen Verhältnisse.
Solche Verhältnisse und Bewusstseinslagen ignoriert Stache, ihm missfällt die Feststellung von Marcuse und anderen kritischen Theoretikern, die Arbeiter*innenklasse in den Metropolen sei integriert. Stache suggeriert, die Apathie der Arbeiter*innenschaft sei lediglich auf die Dominanz rechtssozialdemokratischer Kräfte in den Gewerkschaften zurückzuführen. Er unterschätzt, wie tief das kapitalistische Konsummodell emotional verankert ist; es wirkt als mentale Barriere gegen den ökologisch notwendigen Um- und Rückbau ganzer Industriezweige.
Die Postwachstumsökonomie, die auf solche Strukturveränderungen fokussiert, nimmt sich Stache am Beispiel Bruno Kerns vor, was nicht ganz verkehrt ist, weil diese Richtung durchaus Relevanz besitzt, wenngleich eher in Gestalt von Saral Sarkar oder Ökofeministinnen wie Maria Mies und Vandana Shiva. Allerdings ist diese Strömung dezidiert antimarxistisch: Als Utopie schwebt ihr eine agrarisch-handwerkliche Dorfgesellschaft vor; Kern und Sarkar warfen Marx vor, eine vermeintliche Überbevölkerung ausgeblendet zu haben. Sinnvoller wäre gewesen, Stache hätte marxistische Vertreter*innen einer Degrowth-Ökonomie diskutiert, wie etwa Kohei Saito.
Eine ökomarxistische Avantgarde?
Zu den Vorzügen des Buches gehört, dass Stache modische Konzepte zerpflückt, etwa die imperiale Lebensweise, an der er bemängelt, dass eine Komplizenschaft zwischen Kapital und Arbeiterklasse nahelegt wird. Der wesentliche Unterschied zwischen den Klassen, also das Privateigentum an Produktionsmitteln und damit die Macht über Investitionen, werde eingeebnet und die Ausbeutung von Lohnabhängigen in den kapitalistischen Metropolen ausgeblendet. Der herrschaftskritisch-intersektionalistischen Richtung um Ulrich Brand und Markus Wissen aber auch dem libertär-trotzkistischen Ansatz, den er anhand der Beiträge Christian Zellers diskutiert, hält er vor, Irrtümer des traditionellen Marxismus, etwa die Unterdrückung der Frau als Nebenwiderspruch wegzuschieben, auf der Ebene der Theorie durch postmoderne Beliebigkeit zu verschlimmbessern. Zurecht betont Stache den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeiter*innenklasse als das zentrale Moment der bürgerlichen Gesellschaft.
Zeller hält er überdies vor, Waffenlieferungen an die Ukraine zu unterstützen und damit den westlichen Imperialismus. Als hätte nicht das Putin-Regime einen Eroberungskrieg gestartet und die ukrainische Zivilbevölkerung seit drei Jahren mit Drohnen und Raketen bombardiert. Stache gehört zu jener Linken, die ausblendet, dass jeder kapitalistische Staat, der dazu in der Lage ist, imperialistische Politik betreibt. Das iranische Regime hat die Menschen des Nahen Ostens durch militärische Eingriffe im Irak, in Syrien, Libanon, Israel und Jemen in Tod und Verderben gestürzt, die Volksrepublik China droht der Republik Taiwan ständig mit Krieg.
Dem herrschaftskritischen wie dem trotzkistischen Ansatz wirft Stache vor, das Proletariat als revolutionäres Subjekt zugunsten der neuen sozialen Bewegungen aufzugeben. Dabei ist ihm klar, dass die real existierende Arbeiterklasse wenig revolutionäre Ambitionen zeigt. Um das zu ändern, empfiehlt Stache einen ökologisch aufgepeppten Leninismus und verfällt damit einem Politizismus, den er anderen vorhält. Die verbliebenen sozialistischen und kommunistischen Grüppchen sollen sich in Plattformen zusammentun, rät er. Echt jetzt? Dinosaurier wie etwa DKP oder MLPD als ökomarxistische Avantgarde?
Daraus soll eine Partei von Berufsrevolutionären hervorgehen, die die Macht im Staat erobern, die »erweiterte Ökodiktatur des Proletariats« errichten, aber den Löffel abgeben soll, sobald der Ökokommunismus erreicht ist. So geschichtsvergessen das ist, so wichtig ist die Frage von Führung und Macht, die Stache aufwirft - ähnlich übrigens wie der Sozialökologe Murray Bookchin, der sich darüber vom Anarchismus verabschiedete, ohne als Leninist zu enden. Realistisch ist, dass die herrschende Klasse eine ökosozialistische Umwälzung im Blut ersticken würde. Dagegen müsste sich eine radikale Linke wappnen.
Christian Stache: System Update oder System Change? Glanz und Elend des Ökosozialismus. Papyrossa 2025, 334 S., br., € 24.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.