- Politik
- Nahost
Palästina: Kampf der Kultur
Israelische Behörden lassen das Palästinensische Nationaltheater stürmen. Repressionen gegen Kultureinrichtungen nehmen zu

Am vergangenen Sonntagabend haben israelische Behörden das Palästinensische Nationaltheater »El-Hakawati« gestürmt, welches sich im von Israel besetzten Ostjerusalem befindet. Die geplante Vorstellung des Abends mit dem Titel »Dreams Under the Olive Tree«, die von Kindern und Jugendlichen gespielt werden sollte, wurde von israelischen Geheimdienstleuten mit der Begründung abgebrochen, dass die Veranstaltung von der Palästinensischen Autonomiebehörde organisiert und finanziert worden sei. Den israelischen Behörden zufolge ist dies verboten, da ganz Jerusalem allein unter der Souveränität Israels stehe – eine Behauptung, die dem Völkerrecht widerspricht. Die Anordnung für die Stürmung des Theaters wurde von Israels rechtsextremem Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, erlassen. Hierbei handelt es sich keineswegs um einen Einzelfall, sondern um ein weiteres Glied der langen Kette von Repressionen gegenüber kulturellen Einrichtungen, die palästinensische Identität thematisieren.
Bereits im Februar und März räumten israelische Polizisten gleich zweimal die beliebte Buchhandlung »Educational Bookshop« in der Salah-Al-Din-Straße (ebenfalls in Ostjerusalem) und inhaftierten den Inhaber des Geschäfts, Mahmud Muna, sowie weitere Familienmitglieder, die dort arbeiten. Es ist klar, so erzählte Mahmud damals kurz nach seiner Freilassung, dass kulturelle Räume, insbesondere jene, die die palästinensische Identität repräsentieren, gezielt angegriffen werden.
Willkür der Besatzungsmacht
Nun traf es das »El-Hakawati-Theater«, welches im Jahr 1984 eröffnet wurde. Teilnehmer*innen und Gäste der Veranstaltung kritisierten die Stürmung der Vorstellung und verwiesen auf die Willkür der israelischen Besatzungsmacht. Das Theater wird neben der Europäischen Union auch von Deutschland, Frankreich und weiteren europäischen Ländern finanziell unterstützt. Die 24-jährige Marian (der Name wurde auf Wunsch der Interviewpartnerin geändert) hat in der Vergangenheit des Öfteren an Veranstaltungen des Theaters mitgewirkt, etwa in Aufführungen, in denen »Dabke« getanzt wurde – ein Folkloretanz, der in Ländern wie Palästina, Libanon, Syrien und Jordanien sehr beliebt ist. »Derartige Aufführungen erfordern meist mehrere Monate Arbeit«, erzählt sie. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, welchen Schock und welche Enttäuschung die Kinder hierbei fühlen mussten.«
Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ist die Repression gegenüber palästinensischen Kultureinrichtungen stark angestiegen. Im vergangenen Jahr brachen rund ein Dutzend israelische Siedler gewaltsam in ein jahrhundertealtes Gebäude ein, das zum Komplex der Khalidi-Bibliothek gehört. Die Bibliothek gehört zu den ältesten palästinensischen Kultureinrichtungen und befindet sich in der Bab Al-Silsila-Straße in der Altstadt von Jerusalem und ist nur wenige Gehminuten von der Al-Aqsa-Moschee entfernt. Die Bibliothek enthält die größte private Sammlung arabischer Manuskripte in Jerusalem. Begleitet wurden die Siedler von schwerbewaffneten israelischen Polizisten, wie der Verwalter der Bibliothek, Radscha Khalidi, berichtete.
Der rechtliche Streit der Familie Khalidi mit israelischen Bewohnern begann jedoch nicht erst im vergangenen Jahr, sondern liegt Jahrzehnte zurück: Er eskalierte mit der israelischen Besatzung Ostjerusalems im Zuge des Sechstagekriegs im Jahr 1967. Seitdem sind dort arabisch-palästinensische Institutionen und Häuser stark von Enteignung und Beschlagnahmungen bedroht. Im Jahr 1968, nur wenige Monate, nachdem es der israelischen Armee gelungen war, Ostjerusalem zu besetzen, konfiszierte sie ein Gebäude östlich des Bibliothekhofs, welches ebenfalls Teil des Khalidi-Komplexes ist. Später wurde das beschlagnahmte Grundstück in eine Jeschiwa (eine Schule, die sich dem Talmudstudium widmet) umgewandelt. Unschwer ist dies durch eine israelische Flagge zu erkennen, die dort hängt und unmissverständlich den Anspruch kennzeichnet.
Immer mehr israelische Flaggen
Allgemein lässt sich sagen, dass auch die Anzahl der israelischen Flaggen im Stadtbild Ostjerusalems seit dem 7. Oktober 2023 stark zugenommen hat. Das Hissen der palästinensischen Flagge wiederum ist zwar nach israelischem Recht nicht ausdrücklich verboten, allerdings begründen israelische Polizisten bzw. Soldaten die Beschlagnahmung von palästinensischen Flaggen oder Inhaftierungen beispielsweise damit, dass die öffentliche Ordnung damit gestört werde, oder etwa mit dem Vorwurf der »Aufhetzung«.
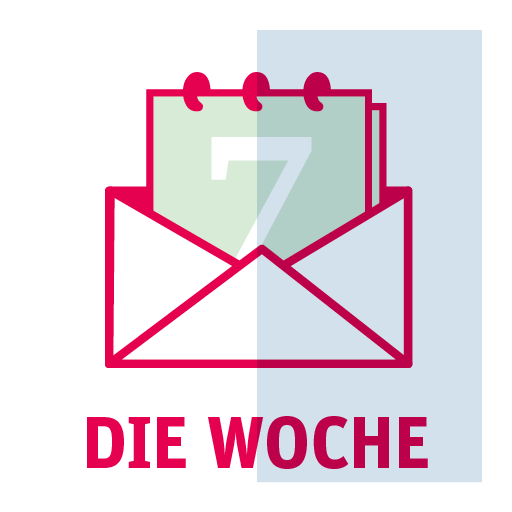
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Der 78-jährige Sliman Mansur, der wohl einflussreichste palästinensische Künstler, berichtet, dass Palästinenser*innen stets versuchten, der Unterdrückung der palästinensischen Identität durch Israel mit kulturellen Aktivitäten entgegenzuwirken. »Das Hauptziel der israelischen Regierung ist es, uns unsere Hoffnung zu rauben und uns zu entmenschlichen. Wir aber hoffen, in diesem Land friedlich und frei leben zu können, mit den gleichen Rechten«, erklärt Mansur, der ein Jahr vor der Staatsgründung Israels geboren wurde.
Die palästinensische Identität wird auch in Israel selbst laufend ausgeblendet, weil man sie als Bedrohung für das eigene nationale (zionistische) Selbstbild betrachtet. In israelischen Schulbüchern etwa werden Palästinenser oder gar die Nakba (also die Vertreibung von rund 750 000 Palästinenser*innen im Zuge des israelisch-arabischen Krieges zwischen 1947 und 1949) nicht erwähnt. In den seltensten Fällen hatte die Unterdrückung der palästinensischen Identität und der Angriff auf deren Kultur jedoch zur Folge, dass diese ihre nationale Identität einfach aufgaben. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Andere Wege zur Vermittlung von Kultur und Geschichte wurden gefunden.
Gemälde in Autos schmuggeln
So erzählt Mansur, dass er und andere palästinensische Künstler*innen in den 80er- und 90er-Jahren ihre Gemälde, die palästinensische Identität thematisierten, in Autos schmuggeln mussten, damit diese nicht vom israelischen Militär konfisziert wurden. Für den Künstler sind die Repressionen von Seiten der Besatzung keineswegs etwas Neues. Um die Zeit der Ersten Intifada herum, die 1987 begann, stellte der Künstler seine Werke ebenfalls in den Räumlichkeiten des El-Hakawati-Theaters aus, woraufhin israelische Soldaten das Gebäude stürmten und die Gemälde an den Wänden beschlagnahmten.
Heute befindet sich Mansurs Atelier in Ramallah. Auch wenn seine Kunst dort nicht mehr im Visier der Besatzungssoldaten steht, so erzählt er, geht die Tötung und Inhaftierung von Palästinensern auch im Westjordanland täglich weiter. »Kunst und Kultur«, so fügt er hinzu, »sind der einzige Weg, diesen Kampagnen der Entmenschlichung entgegenzutreten.«
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.






