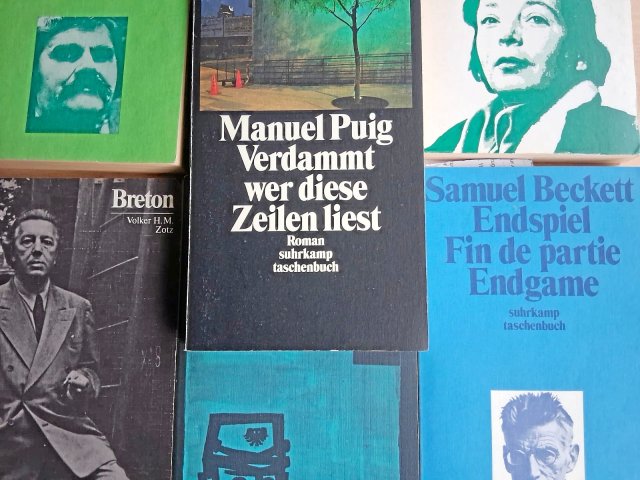- Kultur
- Komische Oper Berlin
»Salome« von Evgeny Titov: Allgegenwärtiges Begehren
An der Komischen Oper Berlin deutet Evgeny Titov »Salome« von Richard Strauss neu aus

Was geschieht, wenn drei fanatische Charaktere aufeinanderprallen? Der Prediger Jochanaan verkündet die Ankunft des Messias, verachtet Frauen als Quelle allen Übels und ist beim König Herodes in einem unterirdischen Verlies gefangen. Salome, die junge und schöne Stieftochter des Königs, ist all der geilen Männer am Hof überdrüssig, die sie angaffen, und will den Einzigen küssen, der sie zurückweist: also Jochanaan.
Herodes schließlich ist mehr an Salome als an seiner Frau Herodias interessiert und verspricht der Stieftochter alles, was sie sich wünscht, wenn sie nur für ihn tanzt. Das tut sie, und als Preis verlangt sie danach Jochanaans Kopf. Der König windet sich, hat Angst, einen Heiligen zu ermorden. Aber er ist an sein Versprechen gebunden. Salome bekommt den Kopf, erlebt den Kuss als Moment ekstatischen Glücks, bevor Herodes befiehlt, sie zu töten.
Das war kurz nach 1900 ein Skandalstück und durfte an der Wiener Hofoper zunächst gar nicht aufgeführt werden. In Berlin gab es »Salome« nur unter der vom Kaiser nahegelegten Bedingung zu sehen, dass am Ende der Stern von Bethlehem am Bühnenhimmel ein versöhnendes Zeichen der Hoffnung markiere. Er habe Strauss ja recht gerne, aber mit diesem Werk werde er sich schaden, ließ Wilhelm II. verlautbaren. Von diesem Schaden habe er sich seine Villa in Garmisch bauen können, replizierte später der geschäftstüchtige Komponist.
Tatsächlich war »Salome« von Beginn an ein Publikumserfolg – und bleibt es bis heute, wo von Skandal nicht mehr die Rede sein kann. Die Dramaturgie ist knapp und schlüssig. Die komplexe Musik fasziniert Kenner, bietet aber zugleich ein Maximum an Klangreizen und einfache, wiedererkennbare Leitmotive. Wer nun das Werk auf die Bühne bringt, steht vor der Aufgabe, angesichts einer Fülle vorliegender Deutungen einen eigenen Akzent zu setzen, ohne auf allzu entlegene Ideen zu verfallen.
Für Evgeny Titovs Inszenierung an der Komischen Oper Berlin hat Rufus Didwiszus ein kahles, mattgoldenes Gewölbe entworfen. Es fehlt die sinnliche Schwüle, mit der man zur Entstehungszeit des Werkes den Orient verband. Die Personen haben wenig Halt; sie suchen ihn im Gegenüber, das sich aber dem Begehren verweigert.
Dieses Begehren ist bei Titov fast allgegenwärtig. Sein Jochanaan wirkt keineswegs immun gegen die Versuchung, die Salome darstellt; Günter Papendell bringt den Propheten stimmlich machtvoll, klar, hart wie Granit zu Gehör. Seine Körperhaltung verrät indessen, wie sehr Salome ihn verlockt, und gerade darum muss der religiöse Eiferer das Begehren verdammen.
Nicole Chevalier als Salome hat es in dieser Inszenierung nicht leicht. Der Regisseur hat ihr eine weiße Haube verpasst, die den ganzen Kopf bedeckt. Sich damit über den Bühnengrund zu bewegen, der einige Klüfte bereithält, ist schwierig genug; darunter zu atmen und dann noch zu einem großen und von Strauss teils massiv eingesetzten Orchester zu singen, muss eine physische Herausforderung sein.
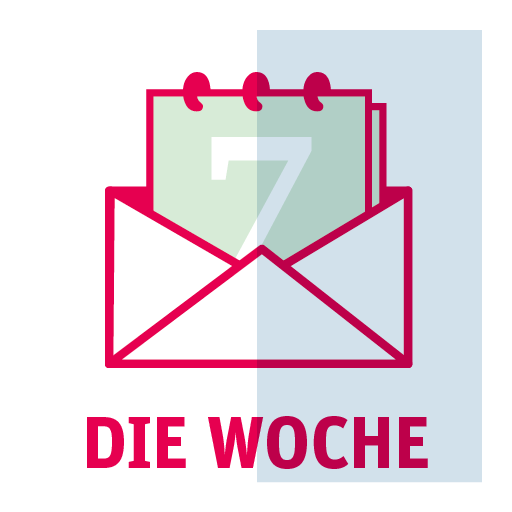
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Chevalier weiß sie zu bewältigen und zudem die ganze geforderte Spannbreite vom scheinbar naiven Gesang bis zum Fast-Sprechen zu erfüllen. Beim Hässlich-Bösen – »Ich will den Kopf des Jochanaan!« – wäre noch eine Steigerung denkbar. Aber das ist Mäkeln auf hohem Niveau. Das Orchester der Komischen Oper unter James Gaffigan spielt sängerfreundlich zurückgenommen, betont die Schärfen der Partitur und nimmt den klanglichen Luxus zurück, der auch zur Perversion gehört.
Matthias Wohlbrecht gibt Herodes einen harten, stechenden Stimmakzent. Dieser König hat zwar die Macht, unmittelbar Schaden anzurichten. Die Angst, die ihn gleichwohl beherrscht, wird selten so deutlich herausgearbeitet; übrigens macht sie ihn nicht weniger gefährlich. Esther Bialas hat für ihn ein giftgrünes Glitzerkostüm entworfen, das das Unseriöse und damit Prekäre dieser Herrschaft betont.
Dass die Hofgesellschaft gekleidet wie zu einer BDSM-Party daherkommt, ist leider überdeutlich; dass sie in den entscheidenden Momenten – Salomes Tanz, der Streit danach – von der Bühne verschwindet, ist ein Schwachpunkt von Titovs Inszenierung. Der König mit seinen Schwächen steht im Theater als öffentliche Figur immer für das Ganze, aber hier fehlt die Gesellschaft.
Es bleibt die Frau. Sie ist Projektionsfläche für Wünsche, wie die leere Maske Salomes andeutet. Ihren Tanz bringt Titov so auf die Bühne, dass sich die Salome-Figuren vervielfältigen, alle mit gleichen Masken. Das erregt den König, denn auf die Vorstellung kommt es an, statt auf die Erfüllung. Das ist ideologiekritisch klug, doch nimmt es Salome ihre Qualität als zielgerichtet Handelnde.
Ungeachtet solcher Einwände: Mit Titovs Arbeit hat die Komische Oper eine respektable »Salome«-Deutung in ihrem Programm.
Nächste Vorstellungen: 7., 12. und 18.12.
www.komische-oper-berlin.de
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.