- Wirtschaft und Umwelt
- Lieferketten
EU-Kommission brach Regeln für Wirtschaftsinteressen
Europäische Ombudsstelle kritisiert Verwässerung der Lieferkettenrichtlinie als undemokratisch und überstürzt

Die Europäische Kommission missachtete bei ihren Deregulierungsvorhaben zur Lieferkettenrichtlinie grundlegende Verwaltungsregeln. Zu diesem Schluss kommt die Ombudsfrau der Europäischen Union, Teresa Anjinho, nach ihrer Untersuchung der Gesetzgebungsverfahren. Die Ombudsstelle prüft als unabhängige Kontrollinstitution der EU Beschwerden über Missstände in der Verwaltungstätigkeit. Sie stellte nun ernste Mängel fest, etwa bei der Verwässerung der Lieferkettenrichtlinie (Omnibus I) und bei der Vereinfachung im Bereich der Agrarpolitik (GAP).
Die Ombudsstelle untersuchte, inwieweit die Kommission bei diesen Gesetzgebungsverfahren die selbst auferlegten Regeln zur »Besseren Rechtsetzung« anwandte. Die Regeln sollen Transparenz, Evidenzbasierung und Inklusivität im Gesetzgebungsverfahren gewährleisten. Anjinho stellte fest, dass die Kommission dagegen verstieß, indem sie sich auf besondere »Dringlichkeit« berief, die sie aber willkürlich auslegte. Gründe für ihre Abweichung von den Regeln seien nicht ausreichend dokumentiert worden.
»Die Kommission muss schnell auf unterschiedliche Situationen reagieren können, insbesondere im aktuellen geopolitischen Kontext«, sagte Anjinho zur Veröffentlichung ihres Untersuchungsberichts. »Sie muss jedoch sicherstellen, dass Rechenschaftspflicht und Transparenz weiterhin Teil ihrer Gesetzgebungsverfahren bleiben und dass ihre Maßnahmen den Bürgerinnen und Bürgern klar erläutert werden.«
Der Bericht zählt im Kern drei grobe Mängel auf: So verkürzte sich die Konsultationszeit zwischen den einzelnen Kommissionsdienststellen teilweise auf weniger als 24 Stunden. Zehn Arbeitstage sind üblich; in dringenden und begründeten Fällen kann die Zeit auf 48 Stunden verkürzt werden. Zweitens bezog man Menschenrechts- und Klimaschutzinitiativen im Gegensatz zu Wirtschaftsverbänden nicht ausreichend in den Prozess ein. Schließlich fehlen klare interne Aufzeichnungen darüber, inwiefern die Vorschläge dahingehend überprüft wurden, ob sie mit den Klimazielen der EU übereinstimmen. Letzteres schreibt das Europäische Klimagesetz vor.
Zivilgesellschaft kritisiert rechte Allianz mit Wirtschaftsverbänden
Die monatelange Untersuchung war im April durch eine Beschwerde von acht Nichtregierungsorganisationen ausgelöst worden, die das Vorgehen der Kommission als »undemokratisch, intransparent und überstürzt« kritisiert hatten.
Die Organisationen sehen ihre Kritik durch die Untersuchung der Ombudsfrau bestätigt. Demnach stellte man Konzerninteressen und Positionen der Wirtschaftsverbände über den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt. »Der Omnibus-Vorschlag wurde unter Ausschluss der Zivilgesellschaft entwickelt, ohne ausreichende Belege oder Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen und mit vorrangigem Fokus auf eng gefasste Industrieinteressen«, heißt es in einer Stellungnahme der European Coalition for Corporate Justice zum Bericht der Ombudsfrau.
Das Omnibus-I-Paket, das die Kommission im Februar dieses Jahres vorschlug, zielt laut Behörde darauf ab, die bürokratische Belastung für Unternehmen zu reduzieren. Dazu sollen Melde- und Sorgfaltspflichten gelockert und so die Wettbewerbsfähigkeit der EU, insbesondere die der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), gestärkt werden.
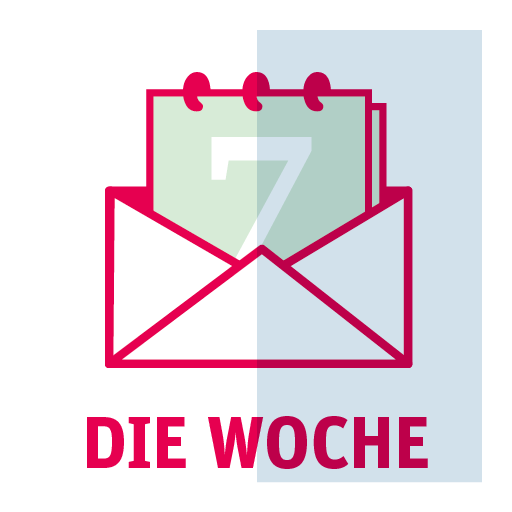
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Kritiker*innen bemängeln jedoch eine umfassende Deregulierung im Bereich des Menschenrechts- und Klimaschutzes. Die erst 2024 in Kraft getretene Lieferketten- und Nachhaltigkeitsrichtlinie sah vor, dass Unternehmen negative Menschenrechts- und Umweltauswirkungen in ihren eigenen Betrieben, bei Tochtergesellschaften und in ihren Wertschöpfungsketten identifizieren, dokumentieren und beheben sollten.
Im Fall der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) reagierte die Kommission auf die Bauernproteste von 2024, indem sie eine Lockerung der GAP-Gesetzgebung vorschlug. Diese soll Landwirten mehr Flexibilität bei der Einhaltung bestimmter Umweltschutzvorschriften geben.
Während die GAP-Lockerung bereits beschlossen ist, befindet sich das Omnibus-Paket noch in der institutionellen Beratung zwischen Kommission, EU-Parlament und Rat. Das Parlament verabschiedete Anfang November seine Verhandlungsposition zum Paket und unterstützte eine weitgehende Verwässerung der Richtlinie. Die Mehrheit kam durch die Stimmen von rechten und extrem rechten Fraktionen zustande, angeführt von der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP).
EU-Kommission weist Vorwürfe zurück
Auf Anfrage des »nd« wies die Kommission die Vorwürfe zurück. Zwar räumte die Behörde ein, dass unter Zeitdruck nicht immer vollständige öffentliche Konsultationen möglich waren, verteidigte jedoch ihre Entscheidungsgrundlage. Nach ihren Aussagen bestand eine »kritische Dringlichkeit« zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. »Diese Dringlichkeit ist keine Behauptung. Es ist das Mandat, das von den Mitgliedstaaten erteilt wurde«, betonte ein Kommissionssprecher mit Verweis auf Beschlüsse des EU-Rates.
Der Rat wollte die Begründung der Kommission auf Anfrage nicht kommentieren. Ein Sprecher teilte aber mit, dass es sich bei den Kommissionsvorhaben um »Übersetzungen« der Schlussfolgerungen des Rates und der EU-Staats- und Regierungschefs handle, die EU-Rechtsvorschriften zu vereinfachen.
Die EU-Kommission kündigte an, die Untersuchungsergebnisse und die Empfehlungen der Aufsichtsbehörde sorgfältig zu prüfen. Ombudsfrau Anjinho empfiehlt, die Regeln zur »Besseren Rechtsetzung« vorhersehbarer und konsistenter zu gestalten. Vor allem muss der Begriff der »Dringlichkeit« näher definiert werden. Das soll verhindern, dass die Klausel willkürlich ausgelegt wird und Interessen einseitig in den Prozess einfließen. Zudem soll besser dokumentiert werden, warum die Kommission von ihren Regeln abweicht. Und es braucht ein Verfahren, das bei entsprechender Dringlichkeit trotzdem dafür sorgt, dass Prinzipien einer »transparenten, evidenzbasierten und inklusiven Rechtsetzung« eingehalten werden, fordert Anjinho.
Die Empfehlungen der EU-Ombudsstelle sind rechtlich nicht bindend, üben jedoch politischen Druck auf die Kommission aus, ihre internen Verfahren zu reformieren.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.






