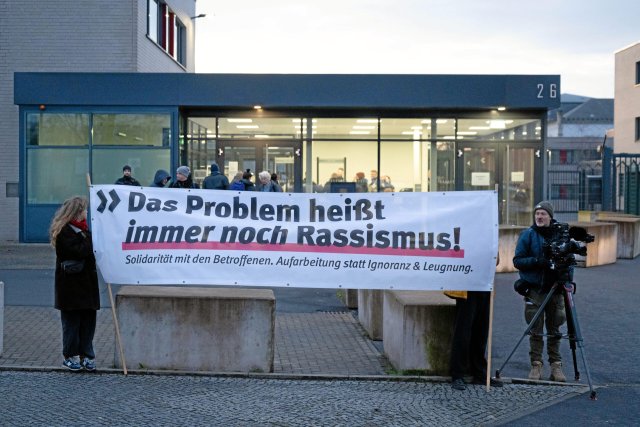Schweden streitet über Jugendstrafen
Verstärkter Polizeieinsatz in Problemvierteln
Dieser Mord hat viele Schweden aufgeschreckt und führte zu Massenkundgebungen und einer heftigen Diskussion über Jugendstrafen und Sozialmaßnahmen: Ein Jugendlicher in Stockholm wurde auf einer Geburtstagsparty von nicht eingeladenen Gleichaltrigen zu Tode misshandelt. Opfer wie Täter kamen aus wohlhabenden Familien. Der Alkohol soll schuld gewesen sein, hieß es später. Die Mörder des 17-jährigen Riccardo wurden jetzt zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt.
Im sozialdemokratisch geprägten Schweden gelten »weiche« Bestrafungen unter Berücksichtigung des oft schwierigen sozialen Umfelds junger Täter als Norm. Das Jugendstrafrecht gilt vom 15. bis zum 18. Lebensjahr. Es wird aber nach richterlichem Ermessen noch bis zum 21. Lebensjahr angewandt. Je nach Schwere der Tat gibt es Jugendhaftstrafen bis zu maximal vier Jahren. Außerdem sind Strafgelder oder unbezahlte Strafarbeit sowie eine dreijährige Bewährungsstrafe möglich. Wiedereingliederungs- und psychosoziale Betreuungsmaßnahmen nehmen eine wichtigere Stellung ein als im Strafrechtssystem für Erwachsene. Vor allem Maßnahmen wie die Zwangsteilnahme an Behandlungsprogrammen für Drogensüchtige oder Gewalttäter werden häufig verordnet. Diese Fälle haben sich in den vergangen 25 Jahren auf über 2700 verfünffacht. Verurteilungen für ernstere Vergehen wie schwere Körperverletzung und Raub sind dagegen seltener geworden. Die Kriminologen streiten nun darüber, ob die Jugendkriminalität zugenommen habe.
Hiesige Studien sagen gerne nein. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen widerspricht dem in einer Zehn-Länder-Studie. »Letztlich ist es immer schwer, eine Aussage über Dunkelziffern zu machen«, meint Björn Fries, schwedischer Experte für Jugendkriminalität, dieser Zeitung. Den dramatischen Anstieg leichterer Straftaten begründen Kriminologen damit, dass die Toleranz gegenüber körperlicher Gewalt deutlich gesunken sei, sie werde schneller angezeigt als früher. Gleichzeitig warnen Sozialarbeiter und Ärzte, dass die Gewalt-Hemmschwelle bei Jugendlichen deutlich gesunken sei und Misshandlungen brutaler ausfielen als früher.
Schwedens bürgerliche Regierung weist jedoch Forderungen nach härteren Strafen oder der Herabsetzung der Strafmündigkeit zurück. »In Schweden gibt es über Parteigrenzen hinweg eine sozialliberale Tradition. Der Fokus liegt da eher auf der Analyse sozialer Probleme und nicht dem Wegstrafen dieser Probleme«, so Fries. Ganz untätig möchte die Regierung aber nicht sein und kündigte an, bis 2010 deutlich mehr Polizeistreifen in Problemvierteln einzusetzen. Zudem sollen Möglichkeiten überprüft werden, verdächtige Jugendliche polizeilich abzuhören und heimlich zu filmen. Zudem wird erwogen, Jugendliche, die des Drogenmissbrauchs verdächtigt werden, gegen ihren Willen zu testen.
Gleichzeitig räumte die Regierung ein, dass die Betreuung Jugendlicher nach abgesessener Haftstrafe sehr dürftig sei. Auch sie soll deutlich verbessert werden.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.