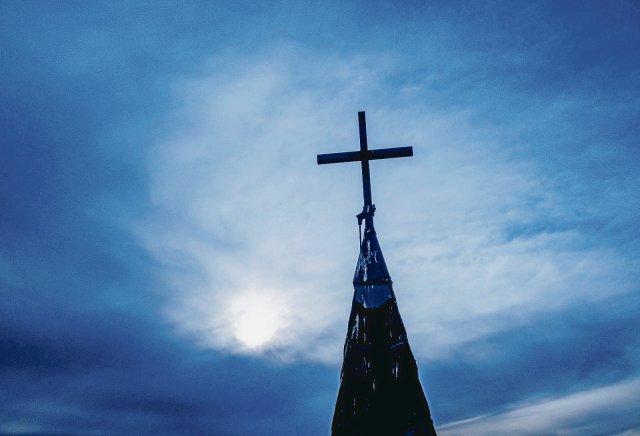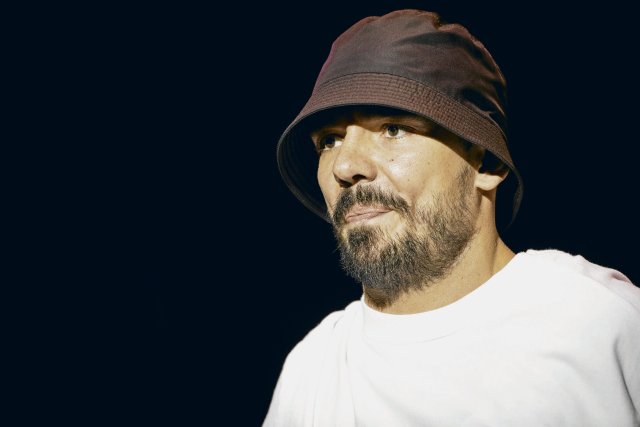- Politik
- Serie: Ein Land im demografischen Wandel
Neues Leben in den Lücken
Im verlassenen Nirgendwo des Nordostens entstehen kleine neue Welten

Als Olaf und Mone Spillner 1985 aus Berlin in den Weiler Hohenbüssow kamen, war dort die Lage nicht viel anders als heute oft beklagt: Der Ort mit Platz für 60, 70 Menschen war im Begriff auszusterben. Neubrandenburg mit seinen Neubaugebieten hatte Bewohner abgesaugt, und als im nahen Alt Tellin moderner Wohnraum geschaffen wurde, blieben nur wenige – die Alten.
Heute ist das ganz anders: Wer von Broock aus auf dem holprigen Pflastersträßchen die Anhöhe von Hohenbüssow erklimmt, sieht schon vor dem Ortseingang deutliche Anzeichen eines blühenden Dorflebens – wenn auch nicht die, die man im ländlichen Nirgendwo zwischen Demmin und der »Vier-Tore-Stadt« Neubrandenburg erwarten würde: ausgebaute Bauwagen mit Panorama-Fenstern, tibetanische Gebetsfähnchen, die im feuchtkalten Aprilwind flattern. Auch an der Dorfstraße, deren Häuschen allesamt bewohnt sind, finden sich merkwürdige Accessoires: Vor einer Kate wacht ein umgestülpter gelber Eimer auf einem krumm gewachsenen Ast; vor einer anderen wachsen zwei bizarr beschnitzte Fühler aus einem Erdwall. Und wer wissen will, was sonst noch so los ist in Hohenbüssow, schaut einfach auf der knallbunten Infotafel in der Nähe des Dorfteichs nach. Von Yoga bis Theater reicht das Angebot im Siebzig-Seelen-Weiler.
Dass es so gekommen ist, ist das Lebenswerk der Spillners. Das jedenfalls bescheinigt eine Urkunde des Vereins »Kultur-Landschaften e.V.«, der ihnen 2003 die Erstausgabe seines »Ludwig-Wegner-Preises« verliehen hat. Nach einem Kunststudium sollten die Spillners, wie damals üblich, auf dem Land »angesiedelt« werden. Ihre Wahl fiel auf den halbverlassenen Flecken, gerade weil er so einsam schien. »Entweder du gehst aus dem Land oder ganz tief in das Land«, hatten sie sich seinerzeit gedacht. Sie haben sich für Hohenbüssow entschieden und seither Freunde, Bekannte und Kollegen nachgeholt. Gerade ist das letzte Haus von einem Bekannten gekauft worden, der jetzt mit dem Ausbau beginnt. Die Gemeinde Alt Tellin, zu der Hohenbüssow gehört, hat seit der Wende nicht an Einwohnern verloren, Hohenbüssow selbst ist heute regelrecht überfüllt – etwa zehn Neu-Dörfler leben sogar ständig in den Bauwagen. Im Sommer kommen dutzende Besucher, die oft für Wochen bleiben. Für sie bauen die Spillners gerade das alte Badehaus der 1821 entdeckten, aber schnell wieder aufgegebenen Heilquelle aus.
Selten genug, dass Menschen in den Nordosten zuwandern. »Seit einigen Jahren ist die Migrationsbilanz in der Altersgruppe 50 plus positiv – aber auch nur in dieser Gruppe«, sagt der Geograf und Landplaner Dr. Michael Heinz von der Uni Greifswald. Oft seien es Rückwanderer, die in den 90ern dem Nordosten den Rücken gekehrt hätten. Zunehmend gibt es aber auch Süd- und Westdeutsche, die in der sauberen Luft ihren Lebensabend verbringen wollen. Nirgends in der Republik ist das Land so billig wie im Nordosten.
Yogalehrer und Dudelsackbauer
Heinz sieht in diesen Einwanderern zwar eine »Chance für die zweite und dritte Reihe«. Während die attraktiven Küstendörfer längst »entwickelt« sind, sagen sich nur wenige Kilometer weiter im Hinterland Fuchs und Hase gute Nacht. Die Senioren-Neubürger trügen zur Belebung bei, sorgten vielleicht für Bau-Aufträge, seien aber kein echter Wirtschaftsfaktor.
Ganz andere Auswirkungen hat das bunte Hohenbüssow auf seine Umgebung. Der Virus hat längst auf die Nachbarflecken übergegriffen. Im nahen Wietzow stehen ebenfalls Bauwagen – und in der ganzen Region am Tollensetal kommt es inzwischen zu einer Belebung von unten. Die unkonventionelle Atmosphäre hat eine ganze Reihe von touristischen, handwerklichen und kunsthandwerklichen Kleinunternehmen angezogen. In Siedenbüssow hat sich ein Ofensetzer auf historische Kachelofentechnik spezialisiert, in Alt Tellin produziert ein Drechlser Dudelsäcke, in Neu Tellin entstehen Keramik-Einzelstücke, in Hohenbüssow hat sich eine Yogalehrerin aus Österreich niedergelassen. Ferner gibt es einen Trommelbauer und mehrere Gutshäuser bieten naturnahen Tourismus.
Vor einigen Jahren ist auch Jörg Kröger aus Lübeck ins Tollensetal gekommen. Er lebt im Gutshaus Wietzow und bietet mit einem Fest-angestellten und zwei Teilzeitkräften Dienstleistungen wie Feldsteinmauern, das Anlegen von Pflasterwegen, Mäharbeiten und Brennholzlieferungen an. Vor allem aber hat Kröger den Alternativbetrieben eine Stimme gegeben. Vor anderthalb Jahren gründete er den Unternehmerverband MILAN – »Mit Lust An Der Natur«. Was mit 6 Betrieben begann, ist inzwischen auf 20 angewachsen. 23 Vollzeitkräften und 14 Teilzeitbeschäftigten bieten die bunten Unternehmen ein Auskommen, Tendenz schnell steigend. Der Verbund gilt unter Planungswissenschaftlern als hoch interessant: »Hier findet echte regionale Wertschöpfung statt«, freut sich Michael Heinz, der schon eine Examensarbeit über die »selektive Zuwanderung« im Tollensetal abgenommen hat.
Ähnliche Ansätze gibt es in etlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns. Zu einiger Bekanntheit ist etwa das Örtchen Klein Jasedow am Usedomer Achterwasser gelangt, über das die preisgekrönte Dokumentation »Siedler am Arsch der Welt« gedreht wurde. Eine Gruppe von Künstlern, Musikern und Heilberuflern mit einigem unternehmerischen Geschick ist 1997 aus der Schweiz gekommen, um den Ort wiederzubeleben und sich den Traum vom gemeinschaftlichen Leben zu erfüllen. Inzwischen gibt es dort eine »Europäische Akademie der heilenden Künste«, die mit einem Bundes-Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde, ein Tagungshaus, einen Musikverlag und einiges mehr.
Ein anderes Beispiel ist der Flecken Starkow an der Barthe im Hinterland des Darß. Das dortige »Art Quartier« bietet kindgerechte Reiterferien in der Natur, ist aber auch ein kleines Zentrum zeitgenössischer Plastik und Bildhauerei – die vom Dorfteich bis zu den Feldrainen präsent ist. Derzeit findet dort ein internationales Bildhauersymposion statt.
»Einfach mal die Landkarte umdrehen«
I nzwischen mehren sich die Plädoyers, solche Initiativen ernster zu nehmen. Im Dezember etwa regte das »Wismarer Stadtgespräch«, ein Forum der »Anstiftung MV«, ein koordiniertes Werben um »Raumpioniere« an. Auch Landplaner Heinz wirbt für ein Umdenken. Man müsse »mental wie praktisch die Landkarte umdrehen«, sagt er und schlägt in Anlehnung an eine ältere MV-Kampagne einen Slogan vor: »Einfach herkommen!« Konzepte für den peripheren ländlichen Raum dürften nicht länger von den Zentren aus gedacht werden.
In der Praxis sind solche Ideen allerdings dünn gesäht. Bisher gab es nur im Kreis Nordvorpommern Ansätze, die oft entleerten »Sackgassendörfer« als »Kreativorte« zu entwickeln. Der tatsächliche Trend geht allerdings weg von den Dörfern. Etliche Berater plädieren sogar dafür, die Entleerung der kleinen Flecken noch zu fördern. Gerade erst haben die Landesentwickler die Kategorie der »ländlichen Zentralorte«, die kleinsten Versorgungs- und Infrastrukturzentren mit 1000 Einwohnern, aus den Regionalen Raumentwicklungsplänen gestrichen. Jetzt sind die »Grundzentren« mit 2000 Einwohnern die unterste Kategorie. Weil die »Zentralörtlichkeit« im Finanzausgleich des Landes eine Rolle spielt, bedeutet das Einkommensminderungen für Orte unter 2000 Einwohnern.
Heinz sieht darin den Startschuss für einen »bedenklichen Konzentrationsprozess im dünnbesiedelten Raum«: »Noch gelten wenigstens die Alten als immobil. Aber was passiert, wenn die jetzt anfangen, ihren Kindern und Enkeln zu folgen?« fragt der Planer. Und gibt selbst die Antwort: »Dann wird es wirklich haarig.«
Ostdeutschland leert sich. Weil zu wenig Kinder geboren werden und viele junge Menschen abwandern, schrumpft die Bevölkerung bis 2020 um 15 Prozent. Die Folgen werden gravierend sein, sind sich Wissenschaft und Politik einig. In einer Serie zeigt ND, welche Auswirkungen der demografische Wandel schon heute hat und wie damit umgegangen wird.
Lesen Sie nächsten Mittwoch:
Ossis im tiefsten Westen

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.