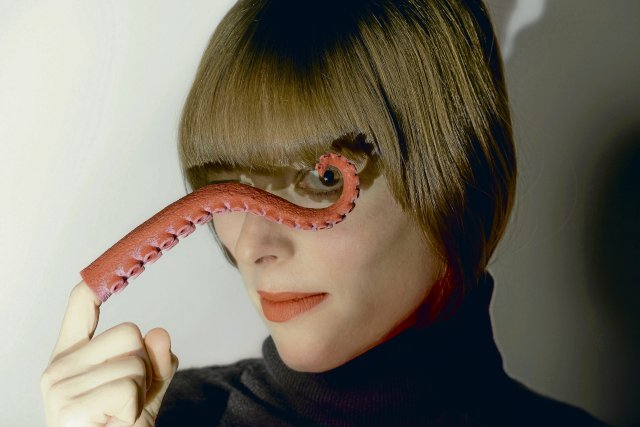Hammer oder Amboss?
Zur Seele: Erkundung mit Schmidbauer
Lerne zeitig klüger sein:
Auf des Glückes großer Waage
Steht die Zunge selten ein;
Du musst steigen oder sinken,
Du musst herrschen und gewinnen,
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboss oder Hammer sein.
So schön ich Goethes Verse finde – seiner Aussage widerspreche ich. Er schreibt von einer Wahl, die oft unmöglich ist und manchmal nicht getroffen werden darf. Achten wir lieber auf das, was zwischen Hammer und Amboss gerät, was von der Wucht kämpferischer Härte zerstört oder doch geformt wird.
Es sind die differenzierten Gefühle, es ist die Bereitschaft zur Empathie. Es ist der innere Widerspruch in Menschen, die zögern, Täter zu werden, um nicht Opfer zu sein. Goethe formuliert die traumatische Alternative schlechthin, das Motto der militärischen Grundausbildung, der Schlagkraft im Felde, der Grobheit, mit der Leistungsmenschen einander und auch ihren Kindern begegnen.
In der Entwicklungspsychologie entspricht dieser Einteilung in gutes Tun und schlechtes Leiden die primitive Spaltung, in der es keine Mischungen gibt, sondern nur Kämpfer oder Memmen, Sieger oder Versager.
Wenn Soldaten in den Krieg ziehen, haben sie nur die Wahl zwischen Hammer und Amboss, zwischen Sieger und Verlierer. Sobald sie aber nach Hause kommen, sobald es darum geht, Liebesbeziehungen aufzubauen oder Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, führt diese Alternative nur zu Leiden und Ängsten. Es geht dann darum, Schläge weder mit Schlägen zu beantworten, noch sie stumm und wehrlos zu erdulden. Statt dessen muss zum Sprechen gebracht werden, was da Schmerzen leidet, sich nach Verständnis sehnt und einer Deformation widerstehen möchte.
Je weiter wir uns in Richtung auf die Zivilgesellschaft entwickeln, desto problematischer werden solche Spaltungen. Aber sie üben eine magnetische Kraft aus und verführen dazu, nicht weiter auf das zu achten, was zwischen Hammer und Amboss zerschrotet wird. Etwa: die Tibeter sind gut, die Chinesen böse; zertrümmert werden die Vorstellungen von Völkerverständigung und friedlichem Spiel zwischen den verhärteten Fronten.
Mein täglicher Anschauungsunterricht über die dumme Wahl zwischen Hammer und Amboss ist die Paartherapie. Wenn in dem Gemenge kindlicher, erotischer und narzisstischer Bedürftigkeiten, das wir Liebe nennen, ein Wunsch grob verletzt wird, ist die Versuchung immens, nicht über diese Verletzung zu sprechen, sondern verletzend zurückzuschlagen. Wenn der Therapeut eines solchen Paares den Streitern gegenübersitzt und versucht, mit einem von ihnen den Konflikt zu klären, entdeckt er ein einsichtiges, manchmal sogar humorvolles Individuum, das mit ein wenig Unterstützung durchaus erkennt, was da beschädigt wurde.
Aber kaum sitzen sich die Hammer-Amboss-Spieler wieder gegenüber, raufen sie um den Hammerstiel. Der Therapeut hat seine liebe Mühe, weitere Schäden zu verhindern und das Verständnis für die Verletzlichkeit des Gegenübers aufrechtzuerhalten.
Warum das so ist? Weil Menschen Augenwesen sind, von der Evolution vorbereitet, von der Erziehung geschult, äußere Probleme schnell zu erkennen und möglichst effektiv zu bewältigen, von ihren inneren Zuständen aber angesichts einer drohenden Gefahr abzusehen.
Der Partner ist angesichts eines unangenehmen Binnenzustandes blitzschnell als Verursacher ausgemacht. Sogleich wird damit begonnen, ihn umzuschmieden. Wenn er sich wehrt und seinerseits Gegen-Schmiedeversuche startet, führt das nicht zur Innenschau, sondern zu verstärkten Bemühungen, endlich selbst zum Zug zu kommen.
Die Lösung kommt aber aus einer Bewegung in die Gegenrichtung: Weder um den Hammer zu kämpfen, noch resigniert den Amboss zu spielen, sondern auszudrücken, was zuschanden geschlagen wird. Sich verabschieden von der Vorstellung, Liebe ließe sich erzwingen, notfalls auch sich trennen von Menschen und Situationen, in denen das Leben eingeengt wird auf den Zwang, Täter zu werden, um nicht Opfer zu bleiben.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.