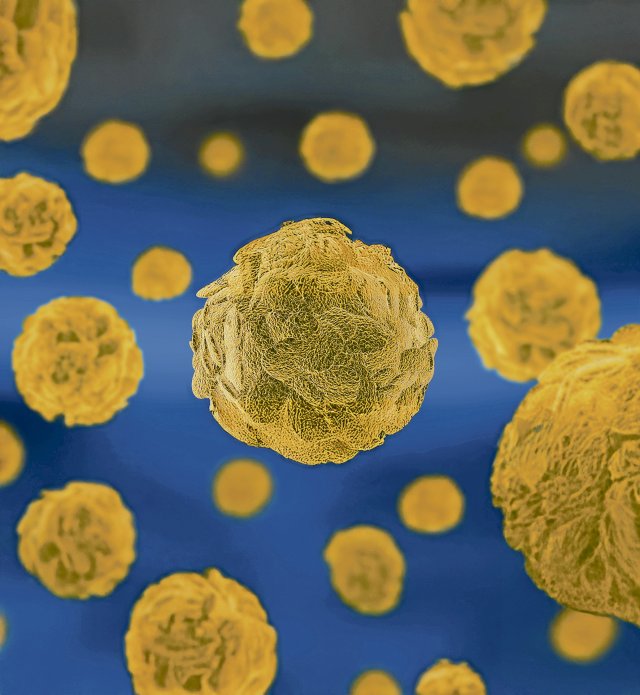Guck mal, wer da spricht
Patienten sollen mehr zu medizinischen Entscheidungen beitragen
52 Ärzte waren vorgewarnt. Sie wussten, dass in den kommenden Monaten junge Frauen bei ihnen über Kopfschmerzen klagen, das Gespräch aber insgeheim aufzeichnen würden. Anschließend würden sie die Mitschnitte an Mitarbeiter der Uniklinik Düsseldorf weiterreichen.
Deren Auswertung belegt, dass es um die Beratung in deutschen Arztpraxen schlecht bestellt ist. Schon beim Vortragen ihrer Beschwerden wurden die vermeintlichen Patientinnen oft unterbrochen. »Die meisten Ärzte intervenierten sofort und begannen dann ihr dominantes Frage-Antwort-Schema«, erzählt der an der Studie beteiligte Germanist Tim Peters. »Selbst bei der Beschreibung der Symptome sprachen die Ärzte die meiste Zeit.« Meldeten die Frauen Zweifel an der Expertenmeinung an, erhoben die Mediziner die Stimme oder gebrauchten Fachbegriffe, um die Patientinnen schnell ruhigzustellen. Ein Arzt brauchte für Gespräch, Untersuchung und Diagnose nicht mehr als 150 Sekunden.
Die Düsseldorfer Studie belegt ein Dilemma, das Experten schon seit Jahren beklagen. Zwischen Arzt und Patient herrscht meist eine hierarchische Beziehung, und darunter leidet die Qualität der Versorgung. »Viele Ärzte lassen Patienten gar keine Wahl«, sagt David Klemperer von der Hochschule Regensburg. »Dabei wollen die meisten Patienten mitentscheiden. Darauf sind viele Ärzte nicht ausreichend vorbereitet.«
Der Mediziner plädiert für eine Kommunikation, die den Bedürfnissen der Patienten gerecht wird. Die Sorge vieler Kollegen, mit aufmerksamem Zuhören und sorgfältigem Informieren kostbare Zeit zu vertrödeln, hält er für unbegründet. »Ein professionell geführtes Gespräch dauert nicht zwangsläufig länger«, so Klemperer. »Gelingt die Erstkommunikation, sind die Folgegespräche eher kürzer.« Manche Studien bestätigen das. Und in einer englischen Untersuchung verlängerte eine vorbildliche Gesprächsführung den Patientenkontakt nur unwesentlich von acht auf zehn Minuten. »Unabhängig vom Zeitaufwand führt an guter Kommunikation kein Weg vorbei«, betont Klemperer.
Dies bestätigt Wolfgang Blank von der Technischen Universität München, der im Bayerischen Wald eine Hausarztpraxis betreibt: »Ich lasse die Patienten ausreden.« Befürchtungen, damit endlose Litaneien zu erdulden, verweist er ins Reich der Mythen. »Wenn man nicht unterbricht, spricht der Patient 30 Sekunden und ist dann still. Wenn ich gezielt nachfrage, dauert es nochmals 60 bis 90 Sekunden«, so Blank. »Dann folgt die Untersuchung. Damit spare ich mir unter Umständen viel Zeit, und der Patient hat das Gefühl ›Der hat zugehört‹ «.
Klemperer und der Medizinpsychologe Martin Härter vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf fordern seit Langem, Patienten grundsätzlich an Entscheidungen zu beteiligen. Der Arzt soll die Informationen liefern, die zum Abwägen wichtig sind. Die Folge für ihn ist, dass er mehr erklären und zudem auch fragen muss, welche Aspekte für einen Patienten wichtig sind. »Vielen Ärzten fällt es schwer, sich von der bisherigen stark hierarchischen Beziehung zu lösen«, sagt Härter. »Aber letztlich sollen die Patienten entscheiden können, welchen diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen sie sich unterziehen.«
Und was ist mit denen, die nicht selbst bestimmen wollen? »Es gibt Menschen, die die Entscheidung lieber in die Hand des Arztes legen«, räumt Härter ein. »Aber auch dann werden die Rollen vorher partnerschaftlich definiert.« Mehr als zwei Drittel der Patienten wollen dem Experten zufolge die Entscheidung entweder allein oder zusammen mit ihrem Arzt treffen. Dass hinter der paternalistischen Haltung mancher Ärzte nicht unbedingt Machtgelüste oder gar finanzielle Eigeninteressen stehen, veranschaulicht Blank am Beispiel eines Mannes, der an Lungenkrebs litt. Dem riet der Arzt, sich in einer entfernten Uniklinik operieren zu lassen, wo man viel Erfahrung mit solchen Eingriffen habe. Der Patient zog dagegen das heimische Krankenhaus vor, weil ihn seine Frau dort täglich besuchen könne.
Shared Decision-Marking
Neu ist das Konzept der gemeinsamen Entscheidungsfindung (Shared Decision-Making) nicht. Die Idee werde in der Ärzteschaft gut aufgenommen, und vielen Kollegen sei der Begriff nicht mehr fremd, sagt der Medizinpsychologe Martin Härter von der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. »Aber in der Fläche wird das noch nicht umgesetzt.« Es wird etwa an der Hälfte der Hochschulen angesprochen oder gelehrt. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern. wwi
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.