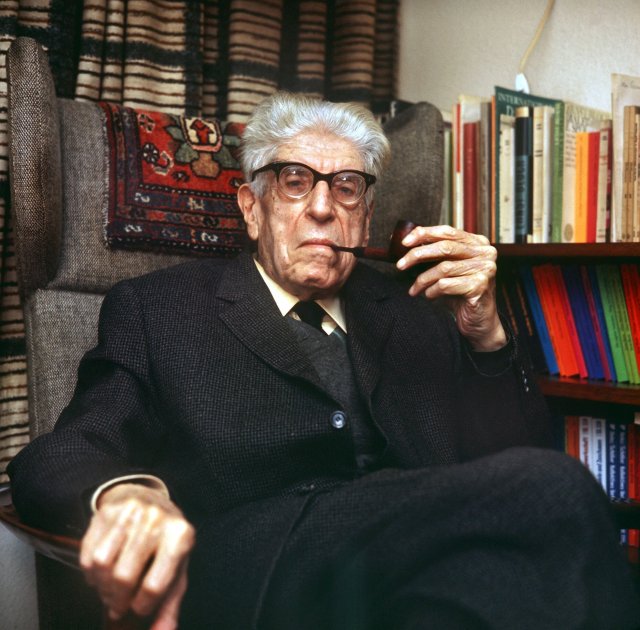Gegen den Strich
Alte Filme und neue Klänge beim Berliner MaerzMusik-Festival
Die MaerzMusik hat endlich zu sich gefunden. Das diesjährige Thema: »Klang – Bild – Bewegung«. Neben Kammermusik sind Filme unterschiedlichster Couleur zu hören und zu sehen. Fertige Streifen mit Originalmusik genauso wie Stummfilme, denen schon etliche Orchestermusiken zugemutet wurden und die nun neue Tonspuren haben oder im Kino erhalten. Livemusik erklingt mit der Option, altem Zelluloid neues Leben einzuhauchen, frühe Bilderwelten mit Jetztwelten zu konfrontieren, Abläufe, Sequenzen zeitgemäß zu rhythmisieren.
Attraktion: die Pionierjahre des Kinos. Fritz Langs monumentaler »Metropolis«-Streifen, versehen mit junger, frech instrumentierter, farbiger, erstaunlich funktionabler Musik von Martin Matalon. Ein filmgeschichtliches Wunderwerk, im Auditiven modernisiert und doch – das ist das Schöne – alt bleibend. Wer will schon die Patina missen, die so sehr anrührt, die Stelle des stummen romantischen Kusses, in Schleier gehüllt, an der die Musik ehrfürchtig schweigt.
Eingebaut ist nicht minder Avantgardistisches der Frühzeit, die Rumorinstrumente des Futurismus etwa oder der Klangdokumentarismus Dsiga Wertows. Der Filmemacher wurde berühmt durch Streifen wie »Der Mann mit der Kamera« (1929) und »Donbass-Symphonie« (1930), den ersten poetischen Dokfilm mit authentischen Klängen und Geräuschen. Wertow feiert auf dem Festival seine Wiederkunft mit dem von Revolution und Aufbau kündenden Filmexperiment »Ein Sechstel der Erde« (1926), wozu Michael Nyman eine neue Musik komponierte. Was dem Konzept des jüdisch-russischen Cineasten, der konsequent auf Originalmaterial abhob, durchaus widerspricht.
Kräftig gegen den Strich des sonstigen, Klassik und Romantik pausenlos reproduzierenden Betriebes bürstet Enno Poppes und Wolfgang Heinigers »Bühnenmusik für 200 Instrumente« mit dem Titel »Tiere sitzen nicht«. Die Performance kam im Radialsystem V nahe Ostbahnhof. Es musizierte die MusikFabrik, ein Ensemble von Rang – ohne Dirigenten. Der war auch nicht nötig. Denn es wird viel improvisiert. Der Witz des Stückes: Es soll alles alt, blechern, schmutzig, wie von anno dunnemals klingen. Nichts, das an Perfektion, an Glätte des Betriebs, an Virtuosentum, an blumige, öde, abgehalfterte Traditionen erinnert. Demnach ist das Instrumentarium ausgesucht. Jeder der 15 Spieler betätigt ein Vielfaches an Klangerzeugern. Haufenweise Schlaginstrumente, Riesentriagel, Kupferbleche, sonstige rohe Bleche, alte Bestecke, Ratschmaterial, Rohholz zum Draufkloppen, vielerlei Blöcke, Gestänge, Röhrchen, überhaupt diverses Metallzeug, Drähte, Glöckchen, missgestaltete Schlegel, alte Stricknadeln etc. Die MusikFabrik verdiente ihren Namen. Dazu eine überwältigende Ansammlung von Tasteninstrumenten, alten Keybords, Orgelmanualen, Orgelfußpedalen, Reiseklavieren, Minicelesten. Das ganze ergibt ein echtes Theaterbild. Nicht ausgespart sind herkömmliche Instrumente. Zwei Tenorhörner quälen sich ein Duo ab. Die Geige sucht den Ausgleich und antichambriert zärtlich vor dem Publikum und vor einem Mikro, wie es Hörspielmacher Alfred Braun 1930 verwendet hat.
Die Musiker tragen alle Schwarz. Einige streben hinauf auf eine Pyramide mit Podesten. Bühnenbild erster Güte. Droben blasen verabredungsgemäß die Trombonisten trockene, unsangliche Blasphonien, während unten das Cello weint wie ein Schlosshund hinter Gittern. Alsbald schwingt sich die geballte Crew der Keyboarder hinauf bis in die unannehmlichsten Tonhöhen und grausamsten Lautstärken. Im Saal kracht es, tost. Elektronik sendet apokalyptische Signale. Alsbald kehrt wieder Ruhe ein. Das Sopransaxophon leidet unterdes bitterlich. Einer der messianischen Schlagzeuger agiert sich virtuos mit Strohbesen aus, sie prallen auf Orangenkartons und aufgehängte Butterbrotpapiere.
»Tiere sitzen nicht«. Ob es wirklich 200 Instrumente sind, die in Anschlag kommen, lässt sich nicht zählen. Und ob ein Mummenschanz animalischer Wesen wirklich intendiert ist, dürfte genauso fraglich sein. Eher scheint das eine Finte, die ratlos machen soll. Natürlich können die Kamele und die Hunde und die Katzen sitzen. Alle Säuger dürften ihren ureigenen Hintern benutzen können.
Schön ist: Lange bevor es losgeht, langweilen sich die Musiker vor den Staus ihrer Instrumente. Die Musik, sie dauert über siebzig Minuten, hebt erst an, als das Licht ausgeht. Im Dunklen jaulen die Hunde am schauerlichsten. Vermittels einer schrecklich klapprigen, crescendierenden Bogenform aus dem Lautsprecher beginnt der Reigen und endet – alle Spieler reißen ihre Mäuler auf, als würden sie singen – wie der Streifen einer Bombe im akustischen freien Fall.
Gratulation den Schöpfern wie den Musikern für diese originelle, so coole wie bissige Performance auf die heutigen Degenerationen des Betriebs, eine Performance, die endlich mal gelungen ist, weil sie die Unkultur des Mitmachens so wunderbar konterkariert.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.