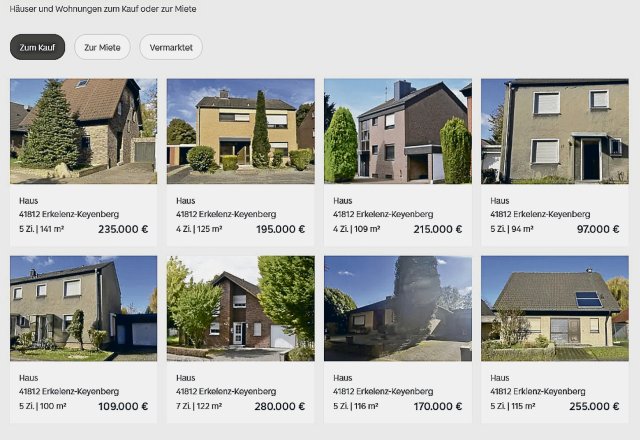Obama im Wahlkampf
USA-Präsident fordert in seiner Rede zur Lage der Nation mehr soziale Gerechtigkeit
In seiner mehr als einstündigen Rede zum »State of the Union« (Lage der Nation) konzentrierte sich Barack Obama fast vollständig auf die Innen- und Wirtschaftspolitik des krisengeschüttelten Landes. Die USA-Außenpolitik handelte er in wenigen Sätzen ab. Er pries noch einmal die Tötung Osama bin Ladens sowie den Rückzug aus Irak und machte den Willen Washingtons deutlich, Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern - für ihn sei da »keine Option vom Tisch«. Aber das klang alles nach Standardsätzen. Konkrete außenpolitische Initiativen des Weißen Hauses in den kommenden Monaten oder gar in einer möglichen weiteren Amtszeit ließ Obama gänzlich aus. Grund ist das Wahlkampfjahr.
Vor den Präsidentschafts- und Kongresswahlen in weniger als zehn Monaten nutzt der Amtsinhaber jede öffentliche Bühne, für sich und seine Partei zu werben beziehungsweise den Gegner zu treffen. Außenpolitik interessiert dabei weder die Wähler, noch lässt sich damit punkten mitten in einer Wirtschaftskrise. Seine Rede hielt Obama vor den Kongressabgeordneten. Aber da sie von mehr als 50 Millionen US-Amerikanern live auf fast allen TV-Kanälen zur Abendzeit gesehen wird, ist in einem Wahljahr nur noch eine wichtiger: die Nominierungsrede, wenn der aussichtsreichste Kandidat der jeweiligen Partei im Spätsommer offiziell gekürt wird.
So ging Obama auf rhetorischen Konfrontationskurs mit den Republikanern, allen voran dem Herausforderer Mitt Romney, dem das Weiße Haus trotz seiner jüngsten Rückschläge gegen Newt Gingrich nach wie vor die besten Chancen auf die Nominierung einräumt. Der Multimillionär, der ein Vermögen von mehr als 250 Millionen Dollar angehäuft hat, bietet sich dabei als ideale Zielscheibe an. Denn am selben Tag hat Romney auf innerparteilichen Druck hin seinen Steuersatz von nur 15 Prozent bekannt gegeben. Zudem soll sich ein Großteil seines Reichtums steuerfrei auf ausländischen Konten befinden.
Obama schlug dagegen vor, dass jeder Amerikaner, der mehr als eine Million Dollar verdient, einen Steuersatz von 30 Prozent entrichten sollte. Dabei bemühte der Präsident das Bild vom »American Dream« und dessen angeblicher Verheißung, nämlich »das Versprechen, dass es dir gut geht, wenn du hart arbeitest; dass du eine Familie haben kannst, ein Haus besitzen, deine Kinder auf die Universität schicken und etwas für später auf die Seite legen kannst«. Aber dafür müsse jeder »eine faire Chance erhalten, seinen fairen Beitrag leisten und sich an dieselben Regeln halten«. Dabei gehe es nicht um »demokratische Werte oder republikanische Werte, sondern um amerikanische Werte«.
Mit ähnlichen populistischen Aussagen, die Umsetzungsvorschläge vermissen lassen, machte Obama weiter. Überflüssige staatliche Funktionen müssten abgeschafft werden. Eine Steuerreform solle dafür sorgen, dass ins Ausland ausgelagerte Arbeitsplätze in die USA zurückkehren, etwa durch Steuerbegünstigungen. Unter seiner Regie seien »über drei Millionen neue Jobs geschaffen worden«, hob Obama hervor. Zur Verhinderung von unlauterem Wettbewerb kündigte er eine Arbeitsgruppe an, die gegen Immobilienfirmen ermitteln soll, die fragwürdige Hypotheken vergaben.
In der Antwort der Opposition gaben sich führende Republikaner aggressiv. Newt Gingrich warf Obama vor, er vertrete eine »extreme Ideologie von Linksaußen«. Und Mitt Romney kritisierte, Obama wolle nichts als »mehr Steuern, mehr Ausgaben, mehr Regierung«.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.