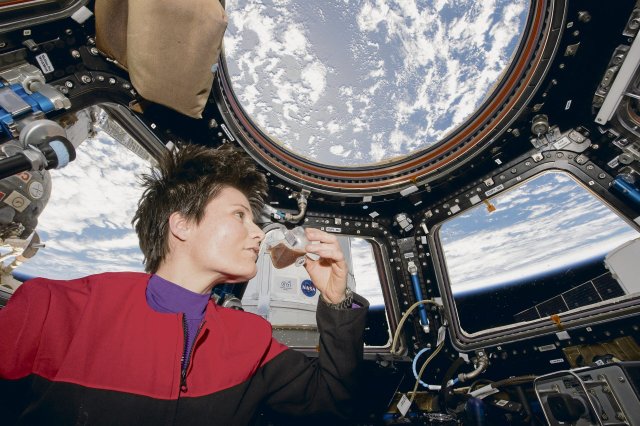Von Menschen und Schimpansen
Vor 125 Jahren wurde der deutsche Psychologe Wolfgang Köhler geboren
Kein anderes Tier ist in seinem Verhalten dem Menschen ähnlicher als der Schimpanse, in dem bereits Charles Darwin 1871 einen unserer nächsten lebenden Verwandten erkannte. Dennoch dauerte es weitere 40 Jahre, ehe unter Wissenschaftlern die Idee reifte, Werkzeuggebrauch und mentale Fähigkeiten von Schimpansen genauer zu untersuchen. Die ersten wichtigen Experimente hierzu machte der deutsche Psychologe Wolfgang Köhler, der von 1914 bis 1920 die Anthropoidenstation der Preußischen Aka᠆demie der Wissenschaften auf Teneriffa leitete.
Sein Ziel war es herauszufinden, ob Schimpansen in gewissen Situationen zu »einsichtigem Handeln« fähig sind. Andere Forscher bezweifelten dies und behaupteten stattdessen, dass das Assoziationslernen (etwa durch Versuch und Irrtum) die einzige Art des Problemlösens bei Tieren sei.
Doch Köhler konnte die Zweifler widerlegen. Um beispielsweise an eine außer Reichweite aufgehängte Banane zu gelangen, stapelten die von ihm naturnah gehaltenen Schimpansen Kiste auf Kiste oder steckten kleine Bambusstäbe so lange ineinander, bis der Stock groß genug war, um die Frucht zu erreichen. Auch das Zurichten einer Holzstange zu einem »Vierkant«, mit dem sich ein Türschloss öffnen ließ, erlernten die Tiere, indem sie das Stangenende viereckig zurecht bissen. Köhler interpretierte solche Aktionen als einsichtiges Handeln, bei dem auf die Problemerkenntnis ein zweckgerichtetes Verhalten folgt. 1917 verfasste er sein Werk »Intelligenzprüfungen an Anthropoiden«, das jedoch wenig Beachtung fand. Erst in den 1950er Jahren wurde es gleichsam wiederentdeckt, als Forscher erneut die mentalen Fähigkeiten von Tieren und deren Verhältnis zu jenen des Menschen untersuchten.
Wolfgang Köhler wurde am 21. Januar 1887 im estnischen Reval geboren. Er studierte unter anderem Physik und Philosophie und erwarb 1909 mit einer Arbeit zur Psychoakustik an der Universität Berlin den Doktortitel. Anschließend ging er nach Frankfurt am Main, wo er gemeinsam mit Max Wertheimer und Kurt Koffka die »Gestaltpsychologie« und damit einen neuen Zweig in der psychologischen Forschung begründete. Hatten Psychologen zuvor versucht, das Seelenleben in immer kleinere Elemente zu zerlegen, betonten Köhler und seine Kollegen den ganzheitlichen Charakter der menschlichen Wahrnehmung. Zur Veranschaulichung sei das Beispiel einer Melodie genannt, die sich prinzipiell nicht über einzelne Noten erfassen lässt. Diese bilden vielmehr ein untrennbares Ganzes, eine Gestalt, die erst so als musikalische Struktur wahrnehmbar ist.
Nachdem die Anthropoidenstation auf Teneriffa 1920 aus Geldmangel geschlossen worden war, übernahm Köhler die Leitung des Psychologischen Instituts der Universität Berlin, während die Schimpansen in den Zoologischen Garten kamen. 1933 protestierte er als einziger deutscher Psychologie-Professor öffentlich gegen die Entlassung jüdischer Kollegen und trat später freiwillig von seiner Professur zurück. 1935 emigrierte er in die USA, lehrte am Swarthmore College in Pennsylvania und wurde 1956 zum Präsidenten der American Psychological Association (APA) ernannt. In den 60er Jahren hielt Köhler Gastvorlesungen an der Freien Universität Berlin. Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch das Psychologische Institut der Humboldt-Universität. Er starb am 11. Juni 1967 in Enfield, New Hampshire.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.