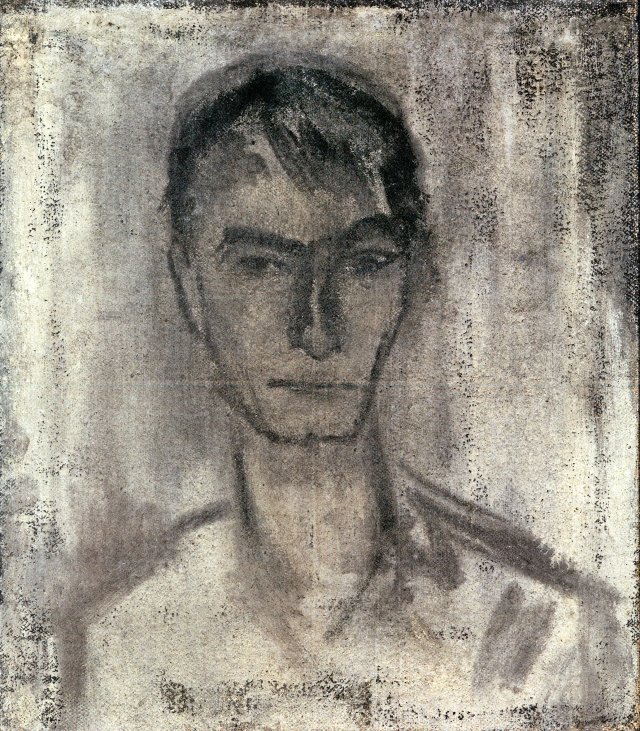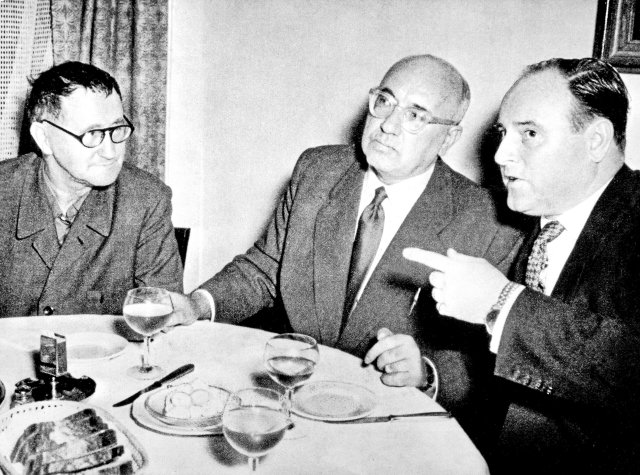Das Geheimnis
»Hinter der Tür«
Die Geschichte spielt in Budapest, in den 60er, 70er Jahren. Eine angehende Schriftstellerin - später erhält sie einen hochangesehenen Literaturpreis - bemüht sich in der Nachbarschaft um eine Haushälterin für sich und ihren Mann. Sie findet sie in der älteren, fleißigen Emerenc, die allerdings ganz eigene Regeln aufstellt, wann und wie sie das Ehepaar versorgt. Dass sie den Hausherrn mit »Gebieter« anredet, ist nur eine ihrer Schrulligkeiten. Doch die Schriftstellerin bemüht sich um die zwar im Umgang schroffe, bei der Arbeit aber umsichtige Frau und gewinnt sogar schließlich deren Vertrauen. Gesten der Fürsorglichkeit füreinander können nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem die jüngere der beiden Frauen nicht nur in den unmittelbar alltagspraktischen, sondern insbesondere in ethischen und moralischen Fragen die Nehmende ist. Eines Tages jedoch, Emerenc hat einen Schlaganfall erlitten, setzt sie deren Vertrauen aufs Spiel.
Istvan Szabós Film bezieht seine Spannung zum größten Teil daraus, dass dem Zuschauer ein Geheimnis enthüllt werden könnte. Nämlich das einer der beiden Hauptfiguren, der Haushälterin. Emerenc wird als ein seltsam eigensinniger Mensch gezeichnet, und ihre Vergangenheit ist ein Munkeln und Vermuten. Dass sie zu ihrer Wohnung niemandem Zutritt gewährt, dient als hauptsächlicher Beleg dafür. Was »hinter der Tür« anderer Leute Wohnung passiert, ist nun mal Antrieb von Neugier.
Die Verfilmung des eben auch auf Deutsch erschienenen Romans »Die Tür« der renommierten ungarischen Schriftstellerin Magda Szabó um eine nie öffentlich gewordene Heldentat aus der Zeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung wartet durchaus mit weiteren Pluspunkten auf. Eine milieugerechte Ausstattung, die eine gutbürgerliche Wohnung der Budapester Nachkriegszeit originalgetreu nachschafft, eine Sorgsamkeit der Kostüme in der Mode der 60er Jahre bis auf den letzten Brokatfaden, eine Fehlerlosigkeit in Schnitt, Licht, Ton, Maske - das ist schon mal was, gelingt nicht jedem, und mancher Film heutzutage scheint sich nicht darum zu scheren. Und die Besetzung der Hauptrollen mit zwei hervorragenden Schauspielerinnen - Helen Mirren und Martina Gedeck -, all das wäre doch zu einem guten Film zusammenzubringen. Denkt man.
Aber, Binse, das beste Einzelne ist in seiner Summe nicht automatisch gut. Manchmal ist das Ganze auch um so schlechter. Das ist hier leider der Fall. Die Filmsprache verdient nur die Bezeichnung altmodisch. Die Szenenfolgen wirken wie das Auf- und Abtreten von Kasperlefiguren in schlechtem Laientheater. Die Schauspieler haben meist - bis auf wenige Momente des Minenspiels von Helen Mirren - hölzern zu agieren.
Überall die geschnitzte Überdeutlichkeit eines Zeigestabs. Das Ausstaffierte wird penetrant und Schubert mit Opus Nr. 56, 15 und 102 gibt so gar keine Ruhe. Am Ende des Films kommt es zu einer Steigerung bis hin - man sagt es ungern bei solch renommiertem Regisseur - zum Kitsch. Was Istvan Szabó dahin getrieben hat, bleibt sein Geheimnis.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.