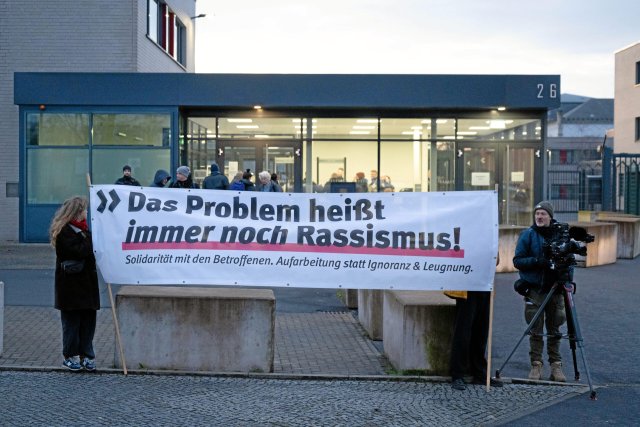Ein Paradies aus Asche
Der Stadtstaat Singapur hat aus den Resten seines Mülls ein Picknickziel im Meer aufgeschüttet
Gemütlich stampft das Ausflugsboot von Singapur in Richtung Pulau (Insel) Semakau. Die Stimmung unter den gut 50 Stadtplanern, Stadtverwaltern und Umweltexperten an Bord ist nach der viertägigen Mammutkonferenz »World Cities Summit« über modernes Stadtmanagement, sauberes Wasser, Umweltprobleme und Müllentsorgung etwas mau.
Trotzdem zücken viele Passagiere ihre Kameras, um Fotos von der Skyline der asiatischen Metropole zu schießen. Ist doch die urbane und zugleich grüne Küste ein Sinnbild von Singapurs Motto »Work hard, Play hard«: Riesenrad, der Kasino-Konferenz-Hotel-Entertainmentkomplex Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Bürotürme, Hunderte Frachtschiffe, hohe Kräne und Containerberge, teuere Apartmentblocks auf der Freizeitinsel Sentosa.
Das Wasser ist erstaunlich sauber. Anders als vor anderen asiatischen Häfen dümpelt vor der Millionenmetropole kein Dreckfeld aus Plastikmüll, Fäkalien, Essensabfällen und Ölschlieren. Und das, obwohl Singapur einer der verkehrsreichsten Häfen der Welt ist und der Inselstaat wegen seiner akuten Landknappheit ganze Raffinerien vor der Küste gebaut hat.
Hoffnungsvoll richten sich die Blicke auf den Horizont, an dem jeden Augenblick Pulau Semakau auftauchen wird. Als das Inselchen erscheint, klicken wieder die Kameras. Semakau ist keine gewöhnliche Insel, sondern eine sehr ungewöhnliche Müllhalde. 1999 schloss Singapur in Lorong Halus die letzte Müllhalde an Land. Smarte Stadtplaner, Ingenieure und Umweltexperten hatten als Ersatz zwei winzige Inseln mit einem sieben Kilometer langen Wall verbunden und so ein zunächst wässeriges, in Zellen unterteiltes Areal von der anderthalbfachen Größe des Berliner Tiergartens geschaffen.
Von dem Müll ist bei der Ankunft nichts zu riechen oder zu sehen, nicht einmal eine Zigarettenkippe. Dabei ist das Inselchen nicht nur unter Müllexperten, Ornithologen, Astrologen und Schulklassen auf Ökotour eine begehrte Adresse, sondern bei den Singapureanern auch ein beliebtes Ausflugsziel. Der Müll wird noch in Singapur verbrannt, die Asche mit Lastkähnen zur Insel transportiert und dort in die Zellen gefüllt. Ist eine Zelle voll, wird sie mit einer dicken Schicht Erde bedeckt und der Natur überlassen. Umweltorganisationen wie Greenpeace sind jedoch skeptisch. Müllverbrennung, warnen sie, sei potenziell krebserregend.
Grünes Tropeneiland
Pulau Semakau präsentiert sich bei der Erkundungstour in den weißen Kleinbussen mit Ivan Yap als kundigem Führer als grünes Tropeneiland. Büsche, Bäume, Wiesen bieten Vögeln, Insekten und Schmetterlingen ein kaum von Menschen gestörtes Habitat. Adler kreisen in der Luft, Reiher stelzen durchs Gras, Otter fühlen sich offenbar wohl. Nur das flache Bürogebäude und die große Halle, in der riesige Bagger die tiefschwarze Asche von den Kähnen zum Transport auf Lkw verladen, verweisen auf die gewerbliche Nutzung der Insel.
Stolz weist Yap auf die Mangroven. »Der alte Wald musste der Inselkonstruktion weichen. Wir haben dann 400 000 Setzlinge per Hand eingepflanzt. Wir geben der Natur zurück, was wir ihr genommen haben.« Rund um die Müllinsel bieten Korallenbänke und Seegraswiesen allerlei Meerestieren Lebensraum. »Wir haben den Damm auf der Innenseite mit einer Gummimembran ausgelegt. Giftstoffe aus der Müllasche können so nicht in das umliegende Gewässer austreten.«
Für das kleine Singapur hat die Insel einen willkommenen Nebeneffekt. Wenn etwa um 2040 die Kapazitätsgrenze von 63 Millionen Kubikmetern Müll erreicht sein wird, hat der durch Landaufschüttung in den letzten Jahrzehnten um mehr als 130 Quadratkilometer gewachsene Staat Singapur 3,5 Quadratkilometer nutzbares Land mehr.
Singapur hat schon in den 1970er Jahren mit einem radikalen Umdenken bei der Müllpolitik begonnen, nicht zuletzt getrieben vom Platzmangel des Staates von der Größe Berlins. Im Mittelpunkt stehen die drei R: »Reduce« (Reduzieren), »Reuse« (Wiederverwenden) und »Recycle«. In vier Anlagen wird heute aus 7900 Tonnen Müll pro Tag Energie erzeugt, immer mehr Müll wird recycelt. 2025, so die Prognose, wird Singapurs Festmüllmenge um 30 Prozent auf mehr als 9000 Tonnen pro Tag steigen.
Singapurs Politiker sind keine Ökologen, eher eine pragmatische Mischung aus politischer Institution und profitorientierter Konzernzentrale. »Wir sind der Überzeugung, dass Wachstum und Nachhaltigkeit zusammen existieren können«, so Umwelt- und Wasserministerin Ministerin Grace Fu.
Müll und seine Entsorgung stellen die größten Herausforderungen der Stadtverwaltungen weltweit dar. Bereits heute lebt gut die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, 2050 werden es zwei Drittel sein. Vor allem in Indien, China und den Tigerstaaten Südostasiens entstehen urbane Metropolenregionen mit mehr Einwohnern als in so manchem der kleineren europäischen Flächenstaaten leben.
Im Zug des Wirtschaftswunders in Asien wächst zudem eine Mittelklasse heran, die gerne konsumiert und viel Müll als Symbol des Wohlstandes empfindet. David Newman, Vizepräsident der Internationalen Festmüllvereinigung (ISWA), konstatiert: »Das haben wir doch gewollt, dass Menschen der Armut entkommen. Nur an das Müllproblem hat niemand gedacht.«
Die Weltbank hat in einer jüngst veröffentlichten Studie eine Bestandsaufnahme des globalen Müllproblems vorgelegt. Darin heißt es: »Eine Stadt ohne eine effektive Müllentsorgung ist selten in der Lage, komplexere Dienstleistungen wie Gesundheits- und Bildungswesen oder öffentlichen Nahverkehr zu managen.« Die Zahlen sprechen für sich. Gegenwärtig produzieren Städte weltweit jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Müll pro Jahr. 2025 werden es 2,2 Milliarden Tonnen sein. Die jährlichen Kosten der Müllentsorgung werden von jetzt 205 Milliarden Dollar auf 375 Milliarden steigen. Nicht eingerechnet sind die Kosten der sozialen und wirtschaftlichen »Nebenwirkungen« wie Gesundheitsprobleme, Standortnachteile, Umweltschäden und Armut. Zudem sind Mülldeponien die drittgrößte Emissionsquelle des Klimaschadstoffs Methan, eines Treibhausgases, das um das 20-Fache wirksamer ist als CO2. Für Antonis Mavropoulos, Leiter der Wissenschaftssektion der ISWA, ist ein effektives Müllmanagement ein Menschenrecht.
Innovative Müllwirtschaft ist aber auch ein großes Geschäft. Müllentsorgung, Müll-zu-Energie, Recycling gelten als ein Wachstumsmarkt, von dem Unternehmen, Arbeitnehmer und die Energieversorgung profitieren. Newman macht eine einfache Rechnung auf: »Pro 1000 Tonnen Müll auf einer Mülldeponie entsteht ein Arbeitsplatz. 1000 Tonnen recycelter Müll schaffen zehn Jobs.«
Im Plastiktütenwahn
Nach zwei Stunden auf Pulau Semakau geht es zurück. Die Seeluft und das Grün auf der Müllinsel haben die Geister der Experten belebt. Während die Sonne hinter dem Äquator versinkt und das Boot Richtung Singapur tuckert, wird an Bord lebhaft diskutiert. Kimhor Meng vom kambodschanischen Umweltministerium kann es kaum erwarten, in Phnom Penh seinen Kollegen zu erzählen, was man alles erreichen kann. »Auch bei uns wären kreative Lösungen des wachsenden Müllproblems möglich«, sagt er. Miezah Kodwo erzählt, in seiner Heimat Ghana würden sich die Behörden redlich um eine ordentliche Müllwirtschaft bemühen. Aber, so der Leiter des Ghana Institute of Waste Management, unter seinen Landsleuten fehle noch jegliches Bewusstsein für Umwelt und Müll.
Während in der Wirtschaft Singapurs die Recyclingquote bereits sehr hoch liegt, haben die privaten Haushalte in Singapur beim Vermeiden und Verwerten noch einigen Nachholbedarf. Die Singapureaner lieben offensichtlich Plastiktüten. Bei einem Testeinkauf im Juli packte die Kassiererin das Obst in eine Tüte, die Zahncreme, den abgepackten Schinken, die Milch jeweils in eine andere - und alles zusammen in eine große Plastiktüte.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.